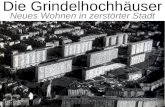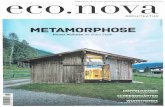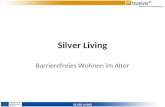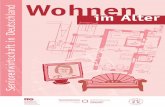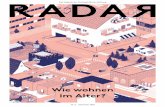Neues Wohnen im Alter
-
Upload
christoph-buecheler -
Category
Documents
-
view
217 -
download
3
description
Transcript of Neues Wohnen im Alter

Gütersloh, 12.09.2005
Neues Wohnen im Alter
Fachtagung von Bertelsmann Stiftung und Institut Arbeit und Technik: Herausforderungen des demographischen Wandels - Selbstbestimmte Lebensformen auch bei Hilfe- und Pflegebedarf ermöglichen
In den nächsten Jahren wird der Bedarf an seniorengerechten Wohnungen enorm zunehmen: Im Jahr 2050 werden fast 30 Prozent der Deutschen über 65 Jahre alt sein - gegenüber 17 Prozent im Jahr 2000. Die Gruppe der Hochbetagten wird überproportional wachsen und mit ihr der Bedarf an Unterstützung und Hilfe bei körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen oder im Pflegefall. Bereits bis 2020 wird die Zahl der älteren Pflegebedürftigen mit Leistungsanspruch um die Hälfte steigen. Für sie würden zwischen 225.000 und 250.000 zusätzliche Heimplätze benötigt - falls keine alternativen Wohnformen bereitgestellt und präventive Maßnahmen ergriffen werden können. Sonst wird der Bedarf bis zum Jahr 2050 eine Größenordnung von 700.000 zusätzlichen Heimplätzen erreichen.
Der demographische Wandel unserer Gesellschaft und die daraus erwachsende Nachfrage nach selbstbestimmten Wohn- und Lebensformen auch bei Hilfe- und Pflegebedarf waren Thema einer Fachtagung von Bertelsmann Stiftung, Landesinitiative Seniorenwirtschaft und Institut Arbeit und Technik (IAT) am 8. und 9. September 2005 in Gelsenkirchen. Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik suchten auf der Tagung nach Konzepten, die den Wohnbedürfnissen älterer Menschen entsprechen und gleichzeitig den zukünftigen gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Veränderungen Rechnung tragen. Auf der Grundlage von Beispielen aus den Bereichen bedarfsgerecht angepasster Wohnraum, aktivierende und unterstützende Dienstleistungen, der Anwendung intelligenter haustechnischer Möglichkeiten und der Wohnumfeld- und Quartiersgestaltung wurden zukunftsorientierte Gestaltungsoptionen für das Wohnen im Alter vorgestellt und diskutiert. Heute leben etwa 70 Prozent der knapp 1,6 Mio. Pflegebedürftigen zu Hause und erhalten Unterstützung durch Familie, Nachbarn und Freunde. Die rund 2,3 Mio. "Hilfebedürftigen", die regelmäßig z. B. hauswirtschaftliche Unterstützung benötigen, werden zu fast 90 Prozent informell versorgt. In den nächsten Jahren werden jedoch die Unterstützungsnetze durch die Familien zurückgehen, da die Kinder berufsbedingt oft nicht mehr in erreichbarer Entfernung wohnen. Auch die Quote der älteren Menschen ohne Kinder nimmt ständig zu. Gegenwärtig ist nur etwa jede 30. ältere Frau kinderlos. In den nächsten zehn Jahren steigt diese Zahl an. Dann wird schon etwa jede 8. und im Jahre 2030 etwa jede 4. über 60-Jährige kinderlos und damit schon deshalb auf alternative Unterstützungsleistungen angewiesen sein. Die Mehrheit des Wohnraumbestandes ist nicht auf die gesteigerten Bedürfnisse älterer Menschen nach Sicherheit, Komfort und weitgehender Barrierefreiheit ausgerichtet. Renovierung und Umbauten steigern aber nicht nur die Lebensqualität von Senioren, sondern schaffen gleichzeitig attraktiven Wohnraum für alle Generationen. Ziel muss dabei sein, mit möglichst wenig Aufwand eine möglichst große Steigerung der Wohnqualität zu erreichen.