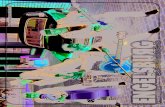Heft 05/2014
Transcript of Heft 05/2014

Sucht im AlterMissbrauch und Abhängigkeit von Substanzen kommen auch bei Menschen im höheren Lebensalter vor, insbesondere die Abhängigkeit von Medikamenten und Alkohol sind verbreitet. Daneben erreichen durch Substitutionsbehandlung und Zugang zu medi zinischer Versorgung mehr und mehr Drogenabhängige ein höheres Alter.
Siegfried Weyerer und Martina Schäufele berichten über „Alkoholprobleme im höheren Lebensalter: Epidemiologie und Möglichkeiten der Intervention“; Gerd Glaeske über „Die Tablette ist wie ein Freund – Medikamentenabhängigkeit im Alter“. Anabela Dias de Oliveira stellt „Wohnhilfen für alternde chronifiziert erkrankte Drogenabhängige – das Projekt LÜSA Unna“ vor.
ISSN 1614-3566A 20690E
Heft 05, September / Oktober 2014 41. Jahrgang
Herausgeber: Deutsches Zentrum für Altersfragen
05
informationsdienst altersfragen

Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
2
Inhalt
Inhalt
Aus der Altersforschung
3 Alkoholprobleme im höheren Lebensalter: Epidemiologie und Möglichkeiten der InterventionSiegfried Weyerer und Martina Schäufele
10 „Die Tablette ist wie ein Freund“ – Medikamentenabhängigkeit im AlterGerd Glaeske
18 Kurzinformationen aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
19 Wohnhilfen für alternde chronifiziert erkrankte Drogen abhängige – Projekt LÜSA UnnaAnabela Dias de Oliveira
26 Kurzinformationen aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem Deutschen Zentrum für Altersfragen
Impressum
Herausgeber: Deutsches Zentrum für AltersfragenManfredvonRichthofenStraße 212101 BerlinTelefon (030) 260 74 00, Fax (030) 785 43 50
DZA im Internet: www.dza.de
Presserechtlich verantwortlich: Prof. Dr. Clemens TeschRömer
Redaktion: Cornelia Au und Dr. Doris Sowarkaida @ dza.de
Gestaltung und Satz: Mathias Knigge (grauwert, Hamburg) Kai Dieterich (morgen, Berlin)
Druck: Fatamorgana Verlag, Berlin
Der Informationsdienst erscheint zweimonatlich. Bestellungen sind nur im Jahresabonnement möglich. Jahresbezugspreis 25,– EURO einschließlich Versandkosten; Kündigung mit vierteljährlicher Frist zum Ende des Kalenderjahres. Bezug durch das DZA. Der Abdruck von Artikeln, Grafiken oder Auszügen ist bei Nennung der Quelle erlaubt. Das DZA wird institutionell gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
ISSN 16143566
27

3
Aus der Altersforschung Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Suchtprobleme im höheren Alter: Eine wachsende Herausforderung
Dem Thema Sucht im höheren Alter wurde lange Zeit wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Aufgrund der demographischen Entwicklung und neuerer epidemiologischer Befunde hat die Fragestellung erheblich an Bedeutung gewonnen (Weyerer u. Schäufele 2011):
– Der Anteil älterer Menschen ist in den vergangenen Jahrzehnten stark angestiegen und wird weiter zunehmen. Der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (2008) zufolge hat sich die Zahl der 65jährigen und älteren Europäer im Laufe des 20. Jahrhunderts verdreifacht und die Lebenserwartung mehr als verdoppelt. Bis zum Jahr 2020 wird über ein Viertel der Europäischen Bevölkerung 65 Jahre oder älter sein. Allein dadurch wird sich – eine konstante Prävalenz von Suchtproblemen vorausgesetzt – die Gesamtzahl der suchtkranken älteren Menschen erhöhen.
– Es spricht Einiges dafür, dass Suchterkrankungen im höheren Alter überproportional ansteigen werden. Schätzungen zufolge könnte sich in Europa zwischen 2001 und 2020 die Zahl der älteren Menschen mehr als verdoppeln, die von problematischem Substanzkonsum betroffen sind oder unter behandlungsbedürftigen Beschwerden infolge von Substanzkonsum leiden. Eine maßgebliche Rolle spielt dabei, dass die zwischen 1946 und 1964 geborene BabyBoomGeneration einen überdurchschnittlich hohen Substanzkonsum aufweist und dieses Konsummuster im höheren Alter häufig beibehalten wird. Ein Indikator für diese Entwicklung ist der ProKopfKonsum an Reinalkohol, der in Deutschland von 1950 mit 3,2 Litern auf 12,9 Liter im Jahr 1980 angestiegen ist. In der Folgezeit kam es zu einem leichten Rückgang des Alkoholkonsums und der ProKopfKonsum lag im
Jahre 2010 bei 9,7 Litern (Gaertner u.a. 2012). Im weltweiten Vergleich gehört Deutschland damit zu den Hochkonsumländern.
– Aufgrund des medizinischen Fortschritts und der verbesserten Behandlungsmöglichkeiten von suchtkranken Menschen ist in Zukunft mit einem Anstieg der Anzahl alt gewordener Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen zu rechnen. Beispielsweise ist in Deutschland von 1980 bis 2005 das durchschnittliche Sterbealter der an alkoholbedingten Erkrankungen Verstorbenen von 53,1 Jahren auf 58,1 Jahre angestiegen (Rübenach 2007).
– Ältere Menschen weisen hinsichtlich der Suchtgefährdung eine Reihe besonderer Risiken auf. Mit dem höheren Alter vermehrt auftretende Verlustereignisse, wie Tod des Partners oder von Freunden, Verkleinerung des sozialen Netzwerks nach Beendigung der Berufstätigkeit und finanzielle Einbußen können ältere Menschen anfällig machen für den Gebrauch von Suchtmitteln. Ein weiteres Risiko für eine erhöhte Suchtgefährdung liegt bei älteren Menschen in dem häufigen Auftreten von körperlichen und psychischen Beschwerden (wie z.B. Schmerzen und Schlafstörungen) sowie von Einschränkungen in den Alltagsaktivitäten.
Alkohol, Tabak und Medikamente mit Abhängigkeitspotential (vor allem Benzodiazepine) sind die quantitativ bedeutsamsten Substanzgruppen im höheren Alter. Ziel dieser Arbeit ist es, Häufigkeit, Risiken und Folgen des Gebrauchs und Missbrauchs von Alkohol im höheren Alter darzustellen und Möglichkeiten der Intervention aufzuzeigen. Dabei sollen epidemiologische Befunde berichtet werden, die sich auf ältere Menschen beziehen, die in Privathaushalten und in Altenpflegeheimen leben.
Aus der Altersforschung
Alkoholprobleme im höheren Lebensalter: Epidemiologie und Möglichkeiten der Intervention
Siegfried Weyerer und Martina Schäufele

4
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014Aus der Altersforschung
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Riskanter Alkoholkonsum
Bei der Klassifikation von Alkoholkonsummustern setzt sich in der epidemiologischen Forschung zunehmend eine erweiterte Sichtweise durch. Diese Sichtweise berücksichtigt neben den manifesten alkoholbezogenen Störungen (schädlicher Gebrauch / Alkoholmissbrauch; Alkoholabhängigkeit) auch Konsummuster unterhalb der klinischen Schwellen. Im Sinne des Präventionsgedankens wird dabei verstärkt auf Konsummuster fokussiert, die zu gesundheitlichen und sozialen Beeinträchtigungen führen können. Von besonderer Bedeutung sind solche Konsummuster gerade bei älteren Menschen: Infolge altersbedingter physiologischer Veränderungen erhöht sich die Sensitivität gegenüber den (negativen) Wirkungen des Alkohols, unter anderem ist auch die Alkoholtoleranz vermindert. Gleichbleibende Konsummengen können deshalb im höheren Alter weitaus mehr schaden als in jüngeren Jahren. Die Vulnerabilität älterer Menschen gegenüber Alkohol erhöht sich umso mehr, je stärker mit dem Alter die Morbidität und, damit verbunden, die (Multi)medikation zunimmt.
Bei der Klassifikation von Alkoholkonsummustern im subklinischen Bereich stößt man auf eine große Vielfalt. Es werden zumeist Richt oder Grenzwerte angewandt, die von verschiedenen Fachgesellschaften auf der Grundlage epidemiologischer Befunde zu den Risiken des Alkoholkonsums abgeleitet wurden. Eine hohe Akzeptanz fanden in Deutschland lange Zeit die Kriterien der BMA (British Medical Association 1995), die unter anderem auch in den Studien von Schäufele u.a. (2009) und Weyerer u.a. (2009) verwendet wurden. Danach beginnt riskanter Alkoholkonsum bei einem Konsum von durchschnittlich mehr als 20 g (20 g entsprechen etwa 0,5 l Bier oder 0,2 bis 0,25 l Wein) reinen Alkohols pro Tag bei Frauen und 30 g bei Männern. Auf der Basis neuerer Erkenntnisse setzt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) mittlerweile den Beginn riskanten Konsums allerdings bei niedrigeren Grenzwerten an: 12 g reiner Alkohol pro Tag für Frauen und 24 g für Männer (Seitz u.a. 2008).
Die „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ (DEGS) liefert die aktuellsten Ergebnisse zum riskanten Alkoholkonsum (Hapke u.a. 2013). Bei 7591 Personen zwischen 18 und 79 Jahren wurde der Risikokonsum nicht nach den BMAKriterien bestimmt, sondern im SelbstausfüllFragebogen erhoben mit drei Fragen des Alcohol Use Disorder Identification TestConsumption (AUDITC). Am häufigsten ist der riskante Alkoholkonsum bei jüngeren Menschen zwischen 18 und 29 Jahren (Männer: 54,2%; Frauen: 36,0%), in der Altersgruppe von 65 bis 79 Jahren (Männer. 34,4%; Frauen: 18,0%) ist die Häufigkeit am geringsten. Die erhebliche Differenz zwischen den Geschlechtern, der altersbezogene Rückgang riskanten Alkoholkonsums und die Zunahme der Prävalenz von Alkoholabstinenz sind Muster, die ungeachtet der methodischen Heterogenität und der teilweise großen Variation der ermittelten Prävalenzraten nahezu in allen bisherigen Untersuchungen vorgefunden wurden (zu einem Überblick siehe Schäufele 2009). In den wenigen Studien, die auch zwischen höheren Altersgruppen differenzieren konnten, zeigte sich, dass die Raten riskanten Konsums auch nach dem 75. Lebensjahr weiter abnehmen. In der Untersuchung von Weyerer u.a. (2009) schrumpfte der Anteil der Konsumenten im Risikobereich von 7,6 % unter den 7579Jährigen auf 5,5 % (80 bis 84 Jahre) bzw. 2,9 % (85 Jahre und älter). Ähnlich wie in anderen Studien zeigte sich auch hier, dass riskanter Alkoholkonsum signifikant mit Tabakrauchen assoziiert ist.
Häufig werden in Bevölkerungsuntersuchungen ältere Menschen ausgeschlossen, die in Institutionen leben. Ende 2011 lebten in Deutschland ca. 30% (743.000) aller pflegebedürftigen Menschen in Einrichtungen der stationären Alten hilfe (Statistisches Bundesamt 2013). Der Alkohol konsum der Heimbewohner wurde in der bundesweiten Studie von Schäufele u.a. (2009) untersucht. Nach einer systematischen Einschätzung durch qualifiziertes Pflegepersonal waren 82,5 % der Bewohner/innen im Bezugszeitraum von vier Wochen alkoholabstinent. Erwartungsgemäß kam Abstinenz deutlich häufiger bei den Frauen (85,4%) als bei den Männern (72%) vor. Riskantes Trinken war insgesamt

5
Aus der Altersforschung Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
bei 0,3 % der Heimbewohner schaft festzustellen, auch hier wesentlich häufiger bei den Männern (0,8 %) als bei den Frauen (0,2 %).
Alkoholbezogene Störungen
Auch bei den klinisch manifesten alkoholbezogenen Störungen, dem schädlichen Gebrauch/ Missbrauch von Alkohol und schließlich der Alkoholabhängigkeit, weisen die bisher vorliegenden Studien ebenfalls konsistent auf einen altersbezogenen Rückgang hin. In Abhängigkeit vom Alter der Referenzgruppen war die Prävalenz alkoholbezogener Störungen unter den Älteren teilweise um mehr als die Hälfte vermindert. Im Gegensatz zu anderen Nationen, insbesondere den USA, ist die epidemiologische Datenbasis in diesem Bereich in Deutschland noch äußerst schwach. Ergebnisse einer älteren Studie aus Oberbayern unterstreichen die internationalen Befunde im Hinblick auf den altersbezogenen Rückgang: Die Rate von 3,1 % behandlungsbedürftigem Alkoholismus unter den 45 bis 64Jährigen Studienteilnehmern reduzierte sich bei den über 65Jährigen auf 0,7 % (Männer: 3,0 %; Frauen: 0,5 %) (Dilling u. Weyerer 1984). In der Berliner Altersstudie, die nur 70Jährige und Ältere einschloss, waren 1,1 % der Probanden von einer alkoholbezogenen Störung nach DSMIIIR betroffen (Helmchen u.a. 1996). Hochgerechnet auf die über 60jährige Bevölkerung sind in Deutschland etwa 400.000 ältere Menschen von Alkoholabhängigkeit betroffen, was nach Bühringer u.a. (2000) eine eher konservative Schätzung darstellt.
Im Vergleich dazu ist die Prävalenz alkoholbezogener Störungen in stationären Pflegeeinrichtungen überdurchschnittlich hoch. Nach aktuellen Befunden aus einer bundesweiten repräsentativen Stichprobe an rund 4.500 Pflegeheimbewohner/inne/n lagen im Mittel bei 5,8 % (17,2 % der Männer und 2,6 % Frauen) der Bewohner/innen ärztlich diagnostizierte (lifetime) Störungen durch Alkohol (ICD 10: F10) vor, die in der Regel bereits bei Heimeintritt bestanden. Die Wahrscheinlichkeit einer (lifetime) Alkoholdiagnose war positiv assoziiert mit: männlichem Geschlecht, jüngerem Alter, weniger sozialen Kontakten mit Verwandten und Freunden,
geringerem Grad an funktionellen Einschränkungen, tendenziell ausgeprägteren Verhaltensproblemen, häufigerem riskanten Alkoholkonsum sowie Rauchen und teilweise mit erhöhter somatischer Morbidität. Zwischen den einzelnen Einrichtungen variierte die Prävalenz alkoholbezogener Störungen von 0 bis 30 %, was darauf hinweist, dass sich einige Einrichtungen auf die Versorgung von älteren Menschen mit chronischen Alkoholstörungen spezialisiert haben (Schäufele u.a. 2009).
Folgen des Alkoholkonsums
Die wenigen epidemiologischen Untersuchungen, die höhere Altersgruppen einschlossen, kamen mehrheitlich zu ähnlichen Befunden wie bei den Jüngeren: Es resultierte eine J oder U förmige Beziehung zwischen der Alkoholkonsummenge und der Entstehung verschiedener Erkrankungen sowie der Überlebenszeit. Demnach ist Alkoholkonsum in geringer bis moderater Dosis nicht schädlicher als völlige Abstinenz (JForm) oder sogar günstiger, entfaltet also eine förderliche Wirkung (UForm). Höhere Konsummengen hingegen können die physische und psychische Gesundheit umfassend schädigen und sind mit schwerwiegenden sozialen Folgen und erheblich reduzierter Lebenserwartung assoziiert.
Nach Moore u.a. (2007) können sich durch überhöhten Alkoholkonsum insbesondere folgende, bei älteren Menschen weit verbreitete Erkrankungen verschlechtern: Bluthochdruck, Diabetes mellitus, gastrointestinale Erkrankungen, Gicht, Schlaflosigkeit, Depression und kognitive Beeinträchtigungen. Infolge der physiologischen Veränderungen bei älteren Menschen ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass selbst der Konsum von geringen Alkoholmengen die Wirkung von zusätzlich eingenommenen Medikamenten verstärken oder herabsetzen bzw. gefährliche Interaktionen hervorrufen. Stürze, Frakturen, Verwirrtheitszustände, Mangelernährung, Inkontinenz und erhöhte Suizidalität sind weitere negative Gesundheitsfolgen, die speziell bei älteren Alkoholkonsumenten vermehrt auftreten.

6
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014Aus der Altersforschung
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Die beschriebenen U oder J Zusammenhänge konnten mehrfach repliziert werden, insbesondere für kardio und zerebrovaskuläre Erkrankungen und die Mortalität. Auch im Hinblick auf demenzielle Erkrankungen, die den Hauptgrund für schwere Pflegebedürftigkeit im Alter darstellen, wurde die beschriebene DosisWirkungsbeziehung von Alkohol durch eine Reihe von Studien konsistent bestätigt (Neafsey u. Collins 2011). An diesen Ergebnissen wird oft kritisiert, dass die positiven Auswirkungen eines leichten/moderaten Alkoholkonsums dadurch zu erklären sind, dass sich in der Gruppe der Alkoholabstinenten ehemalige Alkoholkranke befinden. Studien, die explizit dieser Frage nachgegangen sind, zeigen: Auch wenn ehemalige Alkoholkranke aus der Gruppe der Abstinenten ausgeschlossen werden, ist nach wie vor eine signifikante Reduktion des Demenzrisikos von durchschnittlich 21% festzustellen (Neafsey u. Collins 2011). Demgegenüber besteht kein Zweifel, dass dauerhafter Alkoholmissbrauch das Risiko für das Auftreten kognitiver Beeinträchtigungen und demenzieller Erkrankungen erheblich erhöht (Gupta u. Warner 2008; Neafsey u. Collins 2011).Die in Deutschland erstmals bei 75jährigen und älteren Menschen erhobenen Befunde (Weyerer u.a. 2011) stehen in Einklang mit Ergebnissen aus dem Ausland: Auch nach Kontrolle einer Vielzahl von anderen Einflussfaktoren (Alter, Geschlecht, Bildung, Alleinleben, Rauchen, Depression, leichte kognitive Störungen, körperliche Erkrankungen, genetisches Risiko) hatten Personen mit geringem bis mäßigem Alkoholkonsum eine signifikant niedrigere Wahrscheinlichkeit, im Laufe eines Beobachtungszeitraums von drei Jahren an einer Demenz zu erkranken. Bezogen auf alle Demenzen war das Risiko um 29% niedriger, bezogen auf die Alzheimer Erkrankung um 42% niedriger.
Allerdings scheint es auch Ausnahmen zu geben: Sehr geringer bis mäßiger Alkoholkonsum im jüngeren bis mittleren Lebensalter kann die Entstehung von Krebserkrankungen begünstigen, vor allem die Entstehung von Tumoren der Mundhöhle, des Schlundes, des Kehlkopfes, der Speiseröhre, des Darmes und der Leber sowie Brustkrebs bei Frauen (Rehm u.a. 2003).
Intervention
Um den Folgen von riskantem Alkoholkonsum in möglichst frühen Phasen vorzubeugen, wurden vor allem im angloamerikanischen Sprachraum sogenannte Kurzinterventionen zum Einsatz in der medizinischen Grundversorgung konzipiert (zu einem Überblick siehe Lieb u.a. 2008; Rumpf u.a. 2009). Kurzinterventionen sind auf die Reduktion des Alkoholkonsums ausgerichtet, umfassen prinzipiell nur wenige Kontakte und bestehen in der Regel aus einer ein bis mehrmaligen Beratung, und/oder dem Aushändigen einer Broschüre.
Im Gegensatz zu jüngeren Bevölkerungsgruppen (z.B. Kaner u.a. 2007) liegen für ältere Menschen nur wenige randomisierte und kontrollierte Studien zur Wirksamkeit von – in der Regel primärärztlichen – Kurzinterventionen vor. Ähnlich wie bei den Jüngeren bestätigte sich in diesen Studien auch für die über 65jährigen Risikokonsumenten: Der Alkoholkonsum ging nach einer Kurzintervention signifikant zurück und Rauschtrinken kam seltener vor (Fleming u.a. 1999).
Geht man davon aus, dass in Deutschland ca. 400.000 über 60Jährige von einer manifesten alhoholbezogenen Störung betroffen sind, weisen die Zahlen der Suchthilfestatistik auf eine eklatante Unterversorgung der älteren Menschen hin. Danach waren 2010 von allen 85.423 ambulant betreuten Alkoholkranken nur 7,2 % 60 Jahre und älter. Ähnlich verhält es sich mit der Inanspruchnahme von Fachkliniken, wo im selben Zeitraum von den insgesamt 25.102 Alkoholkranken nur 6,0 % 60 Jahre und älter waren (Steppan u.a. 2012).
Im Kontrast dazu stehen die Ergebnisse von Wirksamkeitsstudien zu psychotherapeutischen Interventionen (zu einem umfassenderen Überblick siehe Lieb u.a. 2008; Rumpf u.a. 2009): Der kurzfristige Therapieerfolg bei Älteren mit alkoholbezogenen Störungen ist ähnlich gut ist wie bei Jüngeren. Bei längeren Katamnesezeiträumen waren die Therapien bei älteren Patienten sogar erfolgreicher als bei jüngeren Patienten.

7
Aus der Altersforschung Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Endnoten:
1 Mittel, die gegen das Substanzverlangen wirken
Nach wie vor mangelt es an spezifischen Therapieangeboten für ältere Menschen, obwohl es Hinweise auf eine höhere Attraktivität und bessere Ergebnisse (längere Abstinenzzeiten, erhöhte Haltequoten) bei altersangepassten Programmen gibt. Die erste randomisierte Studie in Deutschland auf diesem Gebiet evaluiert ein solches altersspezifisches Therapiemanual (KOALA: Kognitive Verhaltenstherapie der Alkoholabhängigkeit im Alter) (Lieb u.a. 2008).
In Zulassungsstudien zur abstinenzorientierten Pharmakotherapie bei Alkoholabhängigkeit im höheren Alter wurden Menschen über 65 Jahre bislang nicht eingeschlossen, weswegen von einer Behandlung älterer Suchtpatienten mit AnticravingSubstanzen 1 derzeit abgeraten wird (Lieb u.a. 2008).
Folgerungen
Für viele chronische Erkrankungen des höheren Lebensalters sind wichtige Risikofaktoren wie übermäßiger Alkoholkonsum seit langem bekannt. Durch eine Reduktion dieser Risikofaktoren in der Bevölkerung ließe sich der Anteil der Personen, die ein hohes Lebensalter in vergleichsweise guter Gesundheit erreichen, deutlich erhöhen. Dies erfordert eine Stärkung präventiver Maßnahmen, die in verschiedenen Lebensaltern weit vor der Hochaltrigkeit ansetzen müssen.
Große Unklarheit herrscht nach wie vor darüber, wie leichter bis moderater Konsum zu definieren ist. In den bisherigen Studien an unterschiedlichen Populationen bewegen sich die Definitionen für diesen Konsumbereich zwischen weniger als zehn und mehr als 40 g reiner Alkohol pro Tag. Häufig fehlen auch Differenzierungen nach Alter und Geschlecht. Eindeutige Empfehlungen zum risikofreien oder gar förderlichen Alkoholkonsum lassen sich darauf kaum gründen, schon gar nicht für ältere Menschen. Bei letzterer Gruppe ist die Befundlage noch besonders dürftig und charakterisiert durch vermehrte methodische Herausforderungen, die längsschnittlichen Beobachtungsstudien immanent sind: Periodeneffekte, Veränderung der Trinkmuster im Lebensverlauf, selektive
Mortalität und Morbidität der Risikogruppen und damit verbunden, der sogenannte „SickQuitterEffekt“ (Rehm u.a. 2003). Die mit steigendem Alter zunehmende Morbidität veranlasst viele ältere Menschen zur Alkoholabstinenz, was wiederum häufig zur Folge hat, dass Abstinenz mit einem schlechteren Gesundheitszustand assoziiert ist als mäßiger Alkoholkonsum.
Noch weisen die epidemiologischen Daten auf einen deutlichen altersbezogenen Rückgang der Prävalenz sowohl von Alkoholdiagnosen als auch von riskanten Konsummustern hin. Vor dem Hintergrund des Anstiegs der Lebenserwartung, der auch bei den Menschen mit problematischem Alkoholgebrauch festzustellen ist, sowie den stark veränderten Konsumgewohnheiten der Nachkriegsgenerationen, insbesondere der Frauen, ist jedoch eine erhebliche Zunahme alkoholassoziierter Erkrankungen und Behinderungen (z.B. Sturzfolgen, kognitive und andere funktionelle Einschränkungen) in der Altenbevölkerung zu erwarten (Gupta u. Warner 2008). Umso mehr gewinnen routinemäßige Screenings und einfache Kurzinterventionen (z.B. Beratungen) zur Reduktion potenziell schädlichen Alkoholgebrauchs an Bedeutung. Hinweise auf die Effektivität und Effizienz solcher Maßnahmen, gerade bei älteren Menschen, liegen aus Studien im angloamerikanischen Raum vor, die im hausärztlichen Setting durchgeführt wurden. Aber auch bei manifesten alkoholbezogenen Störungen besteht – den wenigen bisher vorliegenden Therapiestudien zufolge – Anlass zu Optimismus, zumal ältere Patienten teilweise bessere Behandlungserfolge erzielten als jüngere Patienten. Besonders hoch sind die Abstinenzraten bei älteren Suchtkranken mit spätem Krankheitsbeginn.
In deutschen Altenpflegeheimen ist der aktuelle Alkoholkonsum sehr niedrig (Schäufele u.a. 2009). Viele Heime scheinen jedoch Versorgungsfunktionen für alt gewordene Alkoholkranke zu erfüllen, d.h. für Personen, die bereits zum Zeitpunkt der Heimaufnahme eine Alkoholdiagnose hatten. Diese Bewohner/ innen stellen eine besondere Herausforderung für die Pflegekräfte dar, u.a. weil sie über proportional häufig Verhaltensprobleme (z.B. aggressives, unkooperatives Verhalten)

8
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014Aus der Altersforschung
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
aufweisen. Auf diese Anforderungen scheinen die Pflegekräfte nur unzureichend vorbereitet zu sein. Eine Schulung des Pflegepersonals im Umgang mit Alkoholkranken, eine adäquate personelle Ausstattung sowie eine konsiliarische Beratung durch Suchtberatungsstellen sind dringend erforderlich.
Der Anteil der 60jährigen und älteren Alkoholkranken liegt sowohl in den ambulanten als auch in den stationären Suchteinrichtungen nur bei etwa 7 %. Suchtexperten kritisieren zu Recht, dass die meisten Suchteinrichtungen bereits ein Alter ab 60 Jahren als Kontraindikation betrachten. Ein Ausbau von Therapieangeboten, die speziell auf ältere Menschen ausgerichtet sind, ist deshalb dringend geboten.
Es ist erfreulich, dass mit der Kampagne der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. – DHS (2006, 2013) der Brückenschlag zwischen Suchthilfe und Altenhilfe hergestellt wurde und die DHS zu dem Thema Sucht im Alter Informationen für Beschäftigte in der Altenpflege veröffentlicht hat. Diese Strategie wurde in Deutschland seit 2010 auch im Rahmen von Forschungsprojekten zu dem Thema „Sucht im Alter“ fortgeführt: in den acht Modellprojekten des Bundesgesundheitsministeriums und dem Förderschwerpunkt der Landesstiftung BadenWürttemberg.Autoreninfo und Kontakt:Professor Dr. phil. Siegfried Weyerer ist Leiter der Arbeitsgruppe Psychiatrische Epi-demiologie und Demographischer Wandel am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim
Kontakt: [email protected]
Professor Dr. sc. hum. Martina Schäufele lehrt Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit mit Erwachsenen und Soziale Gerontologie an der Hochschule Mannheim, Fakultät für Sozialwesen
Kontakt: [email protected]

9
Aus der Altersforschung Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Literatur:
British Medical Association (1995): Alcohol: guidelines on sensible drinking. London, British Medical Association.
Bühringer, G., Augustin, R., Bergmann, E., Bloomfield, K., Funk, W., Junge, B., Kraus, L., MerfertDiete, C., Rumpf, H.J., Simon, R. u. Töppich, J. (2000): Alkoholkonsum und alkoholbezogene Störungen in Deutschland. BadenBaden, Nomos.
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg.) (2006): Substanzbezogene Störungen im Alter. Informationen und Praxishilfen. Hamm; Neuauflage 2011.
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg.) (2013): Alkohol, Medikamente, Tabak: Informationen für die Altenpflege. Hamm.
Dilling, H. u. Weyerer, S. (1984): Psychische Erkrankungen in der Bevölkerung bei Erwachsenen und Jugendlichen. In: Dilling, H., Weyerer, S. u. Castell, R. (Hrsg.). Psychische Erkrankungen in der Bevölkerung (S. 1 – 122). Stuttgart, Enke.
Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (Hrsg.) (2008): Substanzkonsum im Alter ein vernachlässigtes Problem. Drogen im Blickpunkt 18, S. 1 – 4.
Fleming, M.F., Manwell, L.B., Barry, K.L., Adams, W. u. Stauffacher, E. A. (1999): Brief physician advice for alcohol problems in older adults: a randomized communitybased trial. Journal of Family Practice, 48, S. 378 – 384.
Gaertner, B., FreyerAdam, J., Meyer, C. u. John, U. (2012): AlkoholZahlen und Fakten zum Konsum. In: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragern e.V. (Hrsg.). Jahrbuch Sucht 2012 (S. 38 – 63). Lengerich, Pabst.
Gupta, S. u. Warner, J. (2008): Alcoholrelated dementia: a 21stcentury silent epidemic? British Journal of Psychiatry, 193, S. 351 – 353.
Hapke, U., von der Lippe, E. u. Gaertner, B. (2013): Riskanter Alkoholkonsum und Rauschtrinken unter Berücksichtigung von Verletzungen und der Inanspruchnahme alkoholspezifischer medizinischer Beratung. Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1). Bundesgesundheitsblatt, 56, S. 809 – 813.
Helmchen, H., Baltes, M.M., Geiselmann, B., Kanowski, S., Linden, M., Reischies, F.M., Wagner, M. u. Wilms, H.U. (1996): Psychische Erkrankungen im Alter. In: Mayer, K.U. u. Baltes, P.B. (Hrsg.). Die Berliner Altersstudie (S. 185 – 219). Berlin, Akademie Verlag.
Kaner, E.F., Beyer, F., Dickinson, H.O., Pienaar, E., Campbell, F., Schlesinger, C., Heather, N., Saunders, J. u. Burnand, B. (2007): Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database Systematic Review, CD004148.
Lieb, B., Rosien, M., Bonnet, U. u. Scherbaum, N. (2008): Alkoholbezogene Störungen im Alter – Aktueller Stand zu Diagnostik und Therapie. Fortschritte der Neurologie Psychiatrie, 76, S. 75 – 85.
Moore, A.A., Whiteman, E.J. u. Ward, K.T. (2007): Risks of combined alcohol/medication use in older adults. The American Journal of Geriatric Pharmacotherapy, 5, S. 64 – 74.
Neafsey, E.J. u. Collins, M.A. (2011): Moderate alcohol consumption and cognitive risk. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 7, S. 465 – 484.
Rehm, J., Room, R., Graham, K., Monteiro, M., Gmel, G. u. Sempos, C.T. (2003): The relationship of average volume of alcohol consumption and patterns of drinking to burden of disease: an overview. Addiction, 98, S. 1209 – 1228.
Rübenach, S.P. (2007): Die Erfassung alkoholbedingter Sterbefälle in der Todesursachenstatistik 1980 bis 2005. Wirtschaft und Statistik, 3, S. 278 – 290.
Rumpf, H.J., John, U., Hapke, U. u. Bischof, G. (2009): Möglichkeiten der Intervention bei Alkoholproblemen im höheren Lebensalter. Sucht, 55 (5), S. 303 – 310.
Schäufele, M. (2009): Epidemiologie riskanten Alkoholkonsums im höheren Lebensalter: eine Übersicht. Suchttherapie, 10, S. 1– 8.
Schäufele, M., Weyerer, S., Hendlmeier, I. u. Köhler, L. (2009): Alkoholbezogene Störungen bei Menschen in Einrichtungen der stationären Altenhilfe : eine bundesweite repräsentative Studie. Sucht, 5, S. 292 – 302.
Seitz, H.K., Bühringer, G. u. Mann, K. (2008): Grenzwerte für den Konsum alkoholischer Getränke. In: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.) (2008). Jahrbuch Sucht 2008 (S. 205 – 208). Geesthacht, Neuland.
Statistisches Bundesamt (2013): Pflegestatistik 2011. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung. Deutschlandergebnisse. Wiesbaden, Statistisches Bundesamt.
Steppan, M., Künzel, J. u. PfeifferGerschel, T. (2012): Jahresstatistik 2010 der professionellen Suchtkrankenhilfe. In: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragern e.V. (Hrsg.). Jahrbuch Sucht 2012 (S. 209 – 240). Lengerich, Pabst .
Weyerer, S. u. Schäufele, M. (2011): Alkohol und Tabak beim älteren Menschen. In: Singer, M.V., Batra, A. u. Mann, K.: Alkohol und Tabak. Grundlagen und Folgeerkrankungen (S. 451 – 457). Stuttgart, Thieme.
Weyerer, S., Schäufele, M., EifflaenderGorfer, S., Köhler, L., Maier, W., Haller, F., CvetanovskaPllashiniku, G., Pentzek, M., Fuchs, A., van den Bussche, H., Zimmermann, T., Eisele, M., Bickel, H., Mösch, E., Wiese, B., Angermeyer, M.C. u. RiedelHeller, S.G. for the German AgeCoDe Study group (German Study on Ageing, Cognition, Dementia in Primary Care Patients)(2009): Atrisk alcohol drinking in primary care patients aged 75 years and older. International Journal of Geriatric Psychiatry, 24, S. 1376 – 1385.
Weyerer, S., Schäufele, M., Wiese, B., Maier, W., Tebarth, F., van den Bussche, H., Pentzek, M., Bickel, H., Luppa M u. RiedelHeller, S.G. for the German AgeCoDe Study group (German Study on Ageing, Cognition and Dementia in Primary Care Patients) (2011): Current alcohol consumption and its relationship to incident dementia: results from a threeyear followup study among primary care attenders aged 75 years and older. Age and Ageing, 40 (4), S. 456 – 463.

10
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014Aus der Altersforschung
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Alter ist einer der wichtigsten Gründe für die Inanspruchnahme des Gesundheitssystems (Winter u.a. 2006). Nach Auswertungen von Daten der ca. 1,6 Millionen Versicherten der Gmünder ErsatzKasse (GEK) aus dem Jahr 2007 suchen in jeder Altersgruppe mindestens 82% der versicherten Männer und 94% der Frauen einmal oder häufiger einen niedergelassenen Arzt auf (Grobe u.a. 2008). Wesentliche Unterschiede in Abhängigkeit vom Alter existieren hingegen bei der Zahl der Arztkontakte. Während Kinder und jüngere Männer (039 Jahre) zwischen 7,5 und 17,1 bzw. Frauen zwischen 9,0 und 17,5 mal jährlich Vertragsärzte aufsuchen, erhöht sich dieser Wert stetig ab etwa dem 40. Lebensjahr. Ab einem Alter von 85 Jahren finden sich unabhängig vom Geschlecht etwa 40 Arztkontakte jährlich. Einen wesentlichen Teil tragen hierzu Besuche bei Allgemeinmedizinern und Internisten bei (Bitzer u.a. 2008). Diese Zahlen sind auch heute noch aktuell. Frauen haben in der Vergangenheit stärker als Männer vom Zugewinn an Lebensjahren profitiert. Während die durchschnittliche Lebenserwartung der Männer bei ihrer Geburt zwischen 1900 und 2010 in Deutschland von 44,8 auf 77,5 Jahre zunahm, stieg sie für Frauen von 48,3 auf 82,6 Jahre. In den höheren Altersklassen überwiegt die Zahl der Frauen die der Männer. Allerdings sind die zusätzlichen Jahre oft nicht frei von Krankheit. Daher hängt der Arzneimittelverbrauch von Alter und Geschlecht ab. Daten aus der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zeigen, dass Männer in den mittleren Altersgruppen mehr und eher teurere Arzneimittel bekommen. Auch die Verordnungshäufigkeit von Arzneimitteln ist stark vom Alter abhängig. So erhielten im Schnitt mindestens 50,7% aller männlichen und 70,1% aller weiblichen Versicherten der BARMER GEK im Jahre 2012 ein oder mehrere Arzneimittel, bei den über 64jährigen Personen waren
es aber mindestens 86,9% der Männer und 93,4% der Frauen. Die Häufigkeit einer Arzneimitteltherapie steigt also mit dem Alter an. Besonders auffällig sind auch hier die Verordnungsmengen (s. Abb. 1), die in der gesamten GKV ab dem Erwachsenen alter (2024 Jahre) von 69 Tagesdosen auf bis zu 1.575 bei 8084jährigen ansteigen. Erwachsene im Alter von über 65 Jahren machen zwar nur etwa ein Viertel (22%) aller gesetzlich Versicherten aus, sie bekommen aber 56% des Verordnungsvolumens nach den Mengen, berechnet in einzelnen Dosierungen. Diese Mengen verursachen 44% der gesamten Arzneimittelausgaben in der GKV. Die Menge der verordneten Mittel hat mit der Behandlung vieler im Alter auftretender chronischer Erkrankungen1 mit kostengünstigen Generika zu tun und erklärt den Unterschied zwischen den Verordnungs und Umsatzanteilen (56% zu 44%). In Abbildung 1 wird diese Verteilungssituation von Mengen (DDD 2) und Kosten (Euro/DDD) für die Versicherten der BARMER GEK gezeigt.
„Die Tablette ist wie ein Freund“ – Medikamentenabhängigkeit im Alter
Gerd Glaeske
Die auffälligsten Unterschiede in der Verteilung von Arzneimitteln auf Männern und Frauen liegen aber nach wie vor im Bereich der psychotropen Arzneimittel 3. Diese Unterschiede fallen vor allem bei den Schlafmitteln und bei Psychopharmaka wie den Antidepressiva, den Neuroleptika und den Tranquilizern auf: Im Jahre 2010 erhielten Frauen mit durchschnittlich 33,4 verordneten Tagesdosen 56% mehr Psychopharmakaverordnungen als Männer mit durchschnittlich 21,0 Tagesdosen. Nur bei den Psychostimulanzien 4 und bei bestimmten Neuroleptika ist der ProKopfVerordnungsanteil von Psychopharmaka bei Männern höher als bei Frauen. Hier scheinen Rollenstereotype einen Einfluss auf die Verordnungen zu haben. 5
Fußnoten:1 z. B. Hypertonie, Herzinsuffizienz oder Diabetes2 DDD: Defined Daily Doses, Tagesdosis3 Arzneimitteln, die auf die Psyche wirken4 anregende Psychopharmaka5 Frauen werden eher mit psychisch bedingten Krankheiten und Belastungen assoziiert, mit Unruhe, Entwertungsgefühlen und depressiven Verstimmungen, Männer mit somatisch bedingten Erkrankungen.

11
Aus der Altersforschung Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Bei älteren Menschen ist vieles anders…
Es ist aber nicht nur die geschlechts und altersspezifische Unterschiedlichkeit der Arzneimittel, die auffällt, es ist vor allem die gleichzeitige Gabe verschiedener Präparate von unterschiedlichen Ärzten, die wenig von den jeweiligen Verordnungen der anderen wissen. Die im Alter zunehmende Multimorbidität führt nicht selten dazu, dass ältere Menschen eine Vielzahl verschiedener Wirkstoffe gleichzeitig verordnet bekommen bzw. im Rahmen der Selbstmedikation einnehmen. 6 In diesem Zusammenhang muss auch besonders die zusätzl iche Rolle der Selbstmedikation älterer Menschen beachtet werden. 7 Diese Arzneimittelmengen werden in den Analysen von Daten der Gesetzlichen Krankenkassen nicht einmal berücksichtigt, da die Mittel ohne Rezept direkt in der Apotheke gekauft und bezahlt werden. Bei älteren Menschen kommen also nicht nur häufige, sondern auch viele Verordnungen nebeneinander zustande. Viele ältere Menschen leiden unter mehreren Krankheiten nebeneinander, an Diabetes neben Bluthochdruck, Herzinsuffizienz oder Osteoporose. Die Multimorbidität steigt mit dem Alter an – etwa die Hälfte der über 65jährigen Bundesbürger leidet unter 3 oder mehr relevanten chronischen Erkrankungen gleichzeitig. Dies führt dann zu einer großen Anzahl der Ärztinnen und Ärzte, die nebeneinander konsultiert werden. Danach haben etwa 43% aller Pati
entinnen und Patienten der BARMER GEK, die im Jahre 2011 ein Rezept erhielten, nur einen einzigen Arzt konsultiert, weitere 30% zwei Ärzte, rund 15% drei Ärzte. Circa 10% gehen zu vier oder fünf Ärzten, danach folgen die restlichen 2% mit deutlich mehr aufgesuchten Ärzten (siehe Tabelle 1). Vor allem bei der Kontaktaufnahme mit mehreren Ärztinnen und Ärzten liegen Frauen deutlich vor den Männern. Insbesondere die Versicherten im höheren Alter (>60Jahre) besuchen mehrere Ärztinnen und Ärzte nebeneinander. 8 Ein älterer Mensch wird danach typischerweise im höheren Alter von durchschnittlich vier Ärztinnen oder Ärzten behandelt. Bei der Analyse von Krankenkassendaten muss in Deutschland zusätzlich berücksichtigt werden, dass Arzneimittel auch auf Privatrezepten für gesetzlich Krankenversicherte verordnet werden und diese nicht in den Kassendaten auftauchen. Besonders gut nachgewiesen ist dieses Phänomen bei Schlafmitteln, von denen ein nicht unerheblicher Verordnungsanteil für GKVVersicherte ältere Menschen auf Privatrezepte entfällt, offenbar eine ansteigende Strategie von Vertragsärzten, um den teilweise unangenehmen Diskussionen von Kassen oder KVSeite über die unangemessene Häufigkeit und Dauer dieser zumeist abhängigmachenden Arzneimittel zu entgehen (Hoffmann u.a. 2006; 2009).
6 Diese gleichzeitige Gabe von verschiedenen Arzneimitteln wird als Polypharmazie (polypharmacy) oder seltener als Polypragmasie bezeichnet.7 z.B. der häufige Einkauf von Schmerz, Abführ oder angeb lichen Stärkungsmitteln, bei denen man vor allem den Alkohol spürt.8 einen Allgemeinarzt oder Internisten als Hausarzt, Frauen eine Gynäkologin oder Gynäkologen, Männer eine Urologin oder einen Urologen, alle älteren Menschen daneben einen Orthopäden und einen Augenarzt.
Abbildung 1: Verordnete DDD pro Versicherte und Ausgaben in Euro pro DDD der BARMER GEK nach Alter und Geschlecht in 2012 (Glaeske und Schicktanz 2013)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
0 - <
5
5 - <
10
10 - <
15
15 - <
20
20 - <
25
25 - <
30
30 - <
35
35 - <
40
40 - <
45
45 - <
50
50 - <
55
55 - <
60
60 - <
65
65 - <
70
70 - <
75
75 - <
80
80 - <
85
85 - <
90
90 - <
95
95 - <
100
> 100
DD
D/V
ers.
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Aus
gabe
n/D
DD
Männer DDD pro Vers. Frauen DDD pro Vers.Männer Ausgaben pro DDD Frauen Ausgaben pro DDD
Die auffälligsten Unterschiede in der Verteilung von Arzneimitteln auf Männern und Frauen liegen aber nach wie vor im Bereich der psychotropen Arzneimittel, also von Arzneimitteln, die auf die Psyche wirken. Diese Unterschiede fallen vor allem bei den Schlafmitteln und bei Psychopharmaka wie den Antidepressiva, den Neuroleptika und den Tranquilizern auf: Im Jahre 2010 erhielten Frauen mit durchschnittlich 33,4 verordneten Tagesdosen 56% mehr Psychopharmakaverordnungen als Männer mit durchschnittlich 21,0 Tagesdosen. Nur bei den Psychostimulanzien, also den anregenden Psychopharmaka, und bei bestimmten Neuroleptika, ist der Pro-Kopf-Verordnungsanteil von Psychopharmaka bei Männern höher als bei Frauen. Hier scheinen Rollenstereotype einen Einfluss auf die Verordnungen zu haben – Frauen werden eher mit psychisch bedingten Krankheiten und Belastungen assoziiert, mit Unruhe, Entwertungsgefühlen und depressiven Verstimmungen, Männer mit somatisch bedingten Erkrankungen.
Bei älteren Menschen ist vieles anders!
Es ist aber nicht nur die geschlechts- und altersspezifische Unterschiedlichkeit der Arzneimittel, die auffällt, es ist vor allem die gleichzeitige Gabe verschiedener Präparate von unterschiedlichen Ärzten, die wenig von den jeweiligen Verordnungen der anderen wissen. Diese gleichzeitige Gabe von verschiedenen Arzneimitteln wird als Polypharmazie (polypharmacy) oder seltener als Polypragmasie bezeichnet. Die im Alter zunehmende Multimorbidität führt nicht selten dazu, dass ältere Menschen eine Vielzahl verschiedener Wirkstoffe gleichzeitig verordnet bekommen bzw. im Rahmen der Selbstmedikation einnehmen. In diesem Zusammenhang muss auch besonders die zusätzliche Rolle der Selbstmedikation älterer Menschen beachtet werden, z.B. der häufige Einkauf von Schmerz-, Abführ- oder angeblichen Stärkungsmitteln, bei denen man vor allem den Alkohol spürt. Diese Arzneimittelmengen werden in den Analysen von Daten der Gesetzlichen Krankenkassen nicht einmal berücksichtigt, da die Mittel ohne Rezept direkt in der Apotheke gekauft und bezahlt werden.

12
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014Aus der Altersforschung
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Zu diesen Produkten gehören neben den Schlafmitteln, die vor allem aus der Familie der Benzodiazepine kommen, eine Gruppe von Arzneimitteln, die seit 1960 angeboten wird, zunächst das Librium, 1963 dann Valium, ein Arzneimittel, das zu den bekanntesten überhaupt gehört und stellvertretend für das Problem „Abhängigkeit“ einer ganzen Generation von Schlaf und Beruhigungsmitteln steht.
Demenz durch Schlaf- und Beruhigungs-mittel?
Immer wieder gibt es Publikationen, die sich mit Medikamenten dieser Arzneimittelgruppen beschäftigen. Eine relativ aktuelle Diskussion betrifft den möglichen Zusammenhang zwischen der langjährigen Einnahme von Benzodiazepinhaltigen Arzneimitteln 10 und dem Auftreten von AlzheimerDemenz. Ein Artikel über eine prospektive Kohortenstudie im renommierten Britischen Ärzteblatt im September 2012 (Billioti de Gage u.a. 2012) hatte diese Diskussion neu entfacht. Die Studie kam, bezogen auf die eingeschlossenen Patientinnen und Patienten, zu dem Ergebnis, dass das Risiko der Entstehung einer AlzheimerDemenz um das 1,6fache gegenüber den NichtBenzodiazepinkonsumenten erhöht sein könnte. Diese Frage ist auch deshalb so wichtig, weil Benzodiazepine (BZ) noch immer zu den häufig verordneten Mitteln in Tranquilizern und Schlafmitteln gehören, die insbesondere für ältere Menschen in allen Ländern vergleichsweise häufig eingesetzt werden und der Anteil der Menschen mit Demenz in Gesellschaften längeren Lebens weiter ansteigen wird. Sol
Tabelle 1: Kontakte der Patienten mit Rezepten (n=7.011.478) zu verschiedenen Ärzten / Arztpraxen im Jahre 2011 nach Geschlecht (Glaeske und Schicktanz 2012)
Anzahl Ärzte/ Arztpraxen
Anzahl Arzneimittel Patienten 9 (in %)
Männer (in %) Frauen (in %)
7.011.478 (100,0%) 2.705.848 (100,0%) 4.305.630 (100,0%)
1 3.035.891 (43,3%) 1.308.411 (48,4%) 1.727.480 (40,1%)
2 2.078.076 (29,6%) 781.376 (28,9%) 1.296.700 (30,1%)
3 1.069.770 (15,3%) 363.963 (13,5%) 705.807 (16,4%)
4 482.798 (6,9%) 151.905 (5,6%) 330.893 (7,7%)
5 204.290 (2,9%) 61.183 (2,3%) 143.107 (3,3%)
> 6 140.653 (2,0%) 39.010 (1,4%) 101.643 (2,4%)
che Benzodiazepine werden eingesetzt, wenn eine schlaffördernde, beruhigende, angst und krampflösende oder auch eine muskelentspannende Wirkung erzielt werden soll. In der (Akut) Psychiatrie, vor Operationen, bei Krämpfen, auch bei Fieberkrämpfen bei Kindern oder bei akuten Schlafstörungen sind sie nach wie vor unverzichtbare Arzneimittel, die rasch wirken und insgesamt gut verträglich sind. Bei einer dauernden Einnahme über zwei bis drei Monate und länger kann eine Abhängigkeit von diesen Mitteln aber kaum noch vermieden werden. 1,5 bis 1,9 Millionen Menschen sind es insgesamt nach Schätzungen von Experten, 1,2 Millionen davon allein von benzodiazepinhaltigen Mitteln, die als Tranquilizer und Schlafmittel verordnet werden. Betroffen sind vor allem ältere Menschen, darunter zwei Drittel Frauen. Als Schlafmittel werden neben den Benzodiazepinen auch Benzodiazepinähnliche Mittel wie Stilnox® mit dem Wirkstoff Zolpidem und Generika, ZopiclonGenerika verordnet. 11 Ob Benzodiazepine das Entstehen einer Demenzerkrankung begünstigen, wird widersprüchlich diskutiert (Gallacher u.a. 2012; Verdoux u.a. 2005; Fastbom u.a. 1998; BoeufCazou u.a. 2011). Ein kausaler Zusammenhang zwischen der regelmäßigen Einnahme von Benzodiazepinen und einer Demenzerkrankung ist zwar schwer zu unter suchen, weil Schlafstörungen und Angstzustände auch die frühen Anzeichen einer beginnenden Demenzerkrankung sein können. Dennoch muss die 2012 publizierte Studie von Billioti de Gage und Kollegen ernst genommen werden. Auch wenn es bisher keinen kausalen Zusammenhang zwischen der langjährigen Einnahme von Benzodiazepinen und dem Auftreten einer Demenz
9 77% aller Versicherten (9.074.877)10 z.B. Adumbran, Dalmadorm, DiazepamGenerika, Tavor u.a.11 Benzodiazepin enthalten Lendormin®, Noctamid®, Radedorm®, FlunitrazepamGenerika, Rohypnol® oder Planum®, als Tranquilizer DiazepamGenerika, Tavor® und LorazepamGenerika, Lexotanil®, Normoc® und BromazepamGenerika, Adumbran® und OxazepamGenerika, Tranxilium® oder Faustan®.

13
Aus der Altersforschung Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
zu geben scheint, so ist schon alleine die Tatsache, dass Menschen mit Demenz über Jahre solche kognitiv einschränkenden Arzneimittel verordnet bekommen, als Fehlversorgung zu kritisieren. Untersuchungen für Deutschland (Glaeske und Schulze 2013) zeigen im Übrigen ähnlich bestürzende Ergebnisse wie in Frankreich: Der Anteil der ohnehin schon in ihren kognitiven Fähigkeiten eingeschränkten Menschen mit Demenz bekommt deutlich mehr dieser ruhigstellenden Benzodiazepine als Menschen ohne Demenz verordnet – das Risiko ist um das 1,5fache erhöht. Die schon bestehenden kognitiven Verschlechterungen dieser Patientinnen und Patienten scheinen für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte kein Grund dafür zu sein, auf diese Mittel zu verzichten. Wenn schon Benzodiazepine und benzodiazepinähnliche Mittel wie ZDrugs grundsätz lichen bei älteren Menschen als eher ungeeignete Mittel gelten – um wie vieles ungeeigneter sind sie dann bei Menschen, die aufgrund ihrer Demenz unter einer progredienten Abnahme ihrer kognitiven, sozialen und kommunikativen
Fähigkeiten leiden? Die Verordnung von Benzodiazepinen für ältere Menschen, insbesondere aber für Patienten mit Demenz, sollte unterbleiben – dies sollte endlich von Ärztinnen und Ärzten berück sichtigt werden. Tilman Jens, der Sohn des kürzlich verstorbenen Walter Jens, hat darauf hingewiesen, dass sein dement gewordener Vater „gespenstische Mengen der tückischen Benzos geschluckt (hat): Tavor und Lexotanil, die Tabletten mit den Benzo diazepinen, jene chemischen Trostspender, die als Marktführer unter den Abhängigkeitsmachern gelten“ 12. Es sollte also dringend weiter untersucht werden, ob sich bei Menschen mit einer langjährigen Benzodiazepinabhängigkeit eine Demenz eher entwickelt als bei denen, die solche Mittel deutlich seltener eingenommen haben – die Versorgungsforschung in diesem Bereich muss daher dringend verstärkt werden. Die bekanntesten Mittel aus dieser Gruppe, die immer noch die größte Bedeutung bei der Arzneimittelabhängigkeit insbesondere auch bei älteren Menschen haben, sind in den Tabellen 2 und 3 genannt.
Tabelle 2: Die 20 meistverkauften synthetischen Schlafmittel (Monopräparate) nach Pa-ckungsmengen im Jahre 2012 (OTC=nicht-rezeptpflichtiges Arzneimittel, nach IMS Health 2013), die Mittel mit einem Abhängigkeitspotenzial sind fett gedruckt. +++ bedeutet hohes Abhängigkeitspotenzial
Rang Präparat WirkstoffAbsatz 2012 in Tsd.
Missbrauchs/ Abhän gigkeitspotenzial
1 Hoggar (OTC) Doxylamin 2.002,4 Eher nicht 13
2 Zopiclon AbZ Zopiclon 1.310,3 ++ (bis +++)
3 Vivinox Sleep (OTC) Diphenhydramin 1.090,5 Eher nicht 13
4 Zolpidem ratio Zolpidem 952,2 ++ (bis +++)
5 Zolpidem AL Zolpidem 740,4 ++ (bis +++)
6 Schlafsterne (OTC) Doxylamin 660,6 Eher nicht 13
7 Zolpidem1A Pharma Zolpidem 614,3 ++ (bis +++)
8 Zopiclon AL Zopiclon 607,4 ++ (bis +++)
9 Zopiclon ratio Zopiclon 598,0 ++ (bis +++)
10 Zopiclon CT Zopiclon 596,0 ++ (bis +++)
11 Lendormin Brotizolam 392,3 +++
12 Zopiclodura Zopiclon 351,3 ++ (bis +++)
13 Zopiclon Stada Zopiclon 335,7 ++ (bis +++)
14 Zolpidem Stada Zolpidem 332,9 ++ (bis +++)
15 Stilnox Zolpidem 317,6 ++ (bis +++)
16 Zopiclon Neuraxpharm Zopiclon 293,1 ++ (bis +++)
17 Noctamid Lormetazepam 288,6 +++
18 Betadorm D (OTC) Diphenhydramin 254,9 Eher nicht 13
19 Zopiclon Hexal Zopiclon 213,0 ++ (bis +++)
20 Lormetazepam AL Lormetazepam 211,0 ++ (bis +++)
Gesamtabsatz synthetische Schlafmittel 16.895,6
12 Der Spiegel, 25, 122, 201313 Diese „ehernichtEinschätzung“ bezieht sich auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Bei missbräuchlich hoch dosiertem Dauerkonsum von Diphenhydramin und Doxylamin (z. B. >200 mg) kann es aber zu Toleranzentwicklung und Entzugssyndromen kommen.

14
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014Aus der Altersforschung
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Langwirksame Schlafmittel 14 können noch am nächsten Morgen zu HangOverEffekten und insbesondere bei älteren Menschen zu Stürzen und schlecht heilenden Knochenbrüchen führen. Es ist daher dringend zu empfehlen, auf diese Schlafmittel bei älteren Menschen zu verzichten und andere Arzneimittel 15 in Erwägung zu ziehen.
Tabelle 3: Die 15 meistverkauften Tranquilizer nach Packungsmengen im Jahre 2012 (nach IMS Health 2013) – Alle genannten Mittel haben ein großes Abhängigkeitspotenzial (+++)
RangPräparat Wirkstoff
Absatz 2012 in Tsd.
Missbrauchs / Abhängigkeitspotenzial
1 Tavor Lorazepam 1.600,3 +++
2 Diazepam ratiopharm Diazepam 1.044,7 +++
3 Bromazanil Bromazepam 508,7 +++
4 Oxazepam ratiopharm Oxazepam 487,1 +++
5 Lorazepam ratiopharm Lorazepam 365,5 +++
6 Lorazepam Neuraxpharm Lorazepam 356,1 +++
7 Adumbran Oxazepam 326,4 +++
8 Lorazepam Dura Lorazepam 266,5 +++
9 Oxazepam AL Oxazepam 204,0 +++
10 Diazepam AbZ Diazepam 181,8 +++
11 Bromazepam1A Pharma Bromazepam 171,0 +++
12 Bromazep CT Bromazepam 166,6 +++
13 Tranxilium Dikaliumclorazepat 163,0 +++
14 Valocordin Diazepam Diazepam 142,7 +++
15 Faustan Diazepam 125,7 +++
Gesamtabsatz Tranquilizer 8.712,5
Insgesamt wurden im Jahre 2012 rund 22 Mio. Packungen solcher Mittel verkauft, die auf Dauer eine hohe Gefahr der Abhängigkeitsentwicklung mit sich bringen. Und die älteren Menschen ab dem 65. Lebensjahr sind vor allem von den Dauerverordnungen betroffen, die letztlich Grund für die Entwicklung einer Abhängigkeit sind.
Schlucken und Schweigen!
Und vielen älteren Menschen geht es ähnlich wie der 63jährigen Lehrerin, die Tag für Tag, seit vielen Jahren, solche Mittel einnimmt. Sie kommt mittags nach Hause, bereitet sich einen Tee und nimmt dazu ein Beruhigungsmittel vom BenzodiazepinTyp ein – zur Entspannung, wie sie sagt, zum Abschalten. „Die Tablette ist für mich wie ein Freund“, so die Begründung für diese Einnahme. Die Frage, ob sie abhängig von diesem Mittel ist, würde sie entrüstet verneinen. Zum einen
14 z.B. Flurazepam, Flunitrazepam, Nitrazepam u.a., z.B. in FlunitrazepamGenerika oder Radedorm®15 z.B. sedierende Antidepressiva oder niedrig potente Neuroleptika wie Melperon®16 rd. 30 Mio. von 633 Mio. im Jahre 2012 im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
hat sie nie die Dosis steigern müssen, zum anderen verschreibt ihr eine Ärztin das rezeptpflichtige Mittel seit vielen Jahren und der Apotheker händigt ihr die Packung kommentarlos aus – diese Experten müssten die „Nebenwirkung“ Abhängigkeit doch kennen und sie darauf hinweisen. Nein, abhängig fühlt sie sich überhaupt nicht, sie fühlt sich wohl mit diesem Mittel, das ihr hilft, den Alltag zu bewältigen. So wie dieser Lehrerin geht es noch immer vielen Menschen in Deutschland: Schätzungen auf Grund der Konsummuster bei diesen Arzneimitteln mit Abhängigkeitspotenzial weisen darauf hin, dass 1,5 Millionen, viele Experten meinen sogar 1,9 Millionen Menschen bei uns abhängig sind von Arzneimitteln, 2/3 von Schlaf und Beruhigungsmitteln, die übrigen von starken Schmerz und Migränemitteln, von Hustenmitteln und Psychostimulanzien. Bei den 2/3 überwiegen die älteren Menschen ab 65 Jahren, wiederum rund 2/3 davon sind Frauen. Die Zahlen sind seit vielen Jahren relativ konstant. Es sind vor allem die verschreibungspflichtigen Mittel, die zu einem Abhängigkeitsproblem führen können, 45% aller ärztlich verordneten Präparate dieser Gruppe 16 haben ein eigenes Abhängigkeitspotenzial. Die Mittel sind – für sich betrachtet – nach wie vor wichtig in der Behandlung, kurzfristig

15
Aus der Altersforschung Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
bei Schlafstörungen, bei Krämpfen oder zur Muskelentspannung vor Operationen. Der Missbrauch in der Verschreibung beginnt aber dann, wenn diese Mittel über zu lange Zeiträume, z.B. länger als 3 Monate hintereinander verschrieben und geschluckt werden – in diesen Fällen ist eine Abhängigkeitsentwicklung kaum noch zu vermeiden. Solange diese Mittel eingenommen werden, wobei bei den meisten Menschen die ursprüngliche Dosierung nicht einmal gesteigert werden muss („lowdosedependency“), sind keine Absetz oder Entzugssymptome zu bemerken, wenn aber diese Mittel nach einer solchen Zeit 3 oder 4 Tage nicht eingenommen werden, kommt es zu Unruhe, Schweißausbrüchen, Schlaflosigkeit oder Aggressionen, typischen Symptomen für einen Entzug. Die fortgesetzte Verschreibung und Einnahme bedeutet damit auch ein „Entzugsvermeidungsverhalten“ – eine therapeutische Wirkung ist nach einer solchen Einnahmezeit nicht mehr zu erwarten. Zu den problematischen Arzneimitteln gehören die meisten Präparate, die in den Tabellen 2 und 3 genannt sind (Glaeske u.a. 2008).
Die Arzneimittelabhängigkeit ist weiblich!
Es sind vor allem ältere Menschen und darunter als Hauptanteil Frauen, die unter der Arzneimittelabhängigkeit leiden, von der sie alleine nur in den seltensten Fällen loskommen. Ambulante Entzugsbehandlungen reichen meist nicht aus, eine stationäre Therapie ist üblicherweise notwendig. Und wer es ambulant versucht, braucht Geduld: Die Mittel vom BenzodiazepinTyp dürfen nie abrupt abgesetzt werden, weil dann Entzugserscheinungen nicht zu vermeiden sind, sie müssen „ausgeschlichen“ werden: Dabei wird die bisher eingenommene Dosierung langsam verringert – zumeist dauert es die Anzahl an Monaten gemessen an der Einnahmezeit in Jahren, um ganz von diesen Beruhigungs und Schlafmitteln loszukommen.
Dass Frauen diese Mittel besonders häufig verordnet bekommen, hängt vor allem auch mit ihrer sozialen Lage in unserer Gesellschaft zusammen. Sie sind – so zeigt es auch die GenderForschung – für Harmonie und Funktionsfähigkeit der Ehe und Familie ver
antwortlich, sie fühlen sich insbeson dere im höheren Alter, wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Arbeit für den Mann im Lebensmittelpunkt steht, entwertet („emptynestsyndrome“), sie leiden unter Unzufriedenheit und Ängsten, unter Schlaflosigkeit und depressiven Verstimmungen. Arzneimittel scheinen sich in solchen Fällen als schnelle Lösung anzubieten, sie stabilisieren und helfen dabei, auch veränderungsbedürftige Situationen in Familie und Gesellschaft aufrechtzuerhalten – schlucken und schweigen! Frauen kompensieren ihre Probleme anders als Männer, sie sind in sich gewandt und leise. Introvertiert; Männer richten ihre Kompensation eher nach außen, werden aggressiv und laut, extrovertiert. Die Arzneimittelabhängigkeit ist daher die typisch weibliche Sucht – unauffällig, nach innen gekehrt, leise und dennoch ebenso problematisch wie die Abhängigkeit von Alkohol, die vergleichsweise typisch bei Männern vorkommt – in nahezu der gleichen Häufigkeit!
Nicht nur Sucht, auch Stürze und Brüche!
Es ist aber nicht nur die Abhängigkeit, die ältere Menschen besonders belastet. Gerade beim Einsatz von Psychopharmaka im Allgemeinen und Benzodiazepinen (zu denen beispielsweise Schlafmittel oder Tranquilizer wie Flurazepam und Diazepam gehören) im Speziellen ist bei älteren Menschen im Vergleich zu jüngeren vermehrt mit unerwünschten Wirkungen zu rechnen (Madhusoodanan u. Bogunovi 2004; Mort u. Aparasu 2002). Im Jahre 1989 berichtete die Arbeitsgruppe um Ray in einer FallKontrollStudie erstmals von einem erhöhten Risiko für Hüftfrakturen bei Älteren im Zusammenhang mit der Einnahme von Benzodiazepinen (Ray u.a. 1989). Seitdem wurden weitere Studien publiziert, die ebenfalls für kurz wirksame bzw. für alle Benzodiazepine eine solche Assoziation zeigen konnten (Herings u.a. 1995; Hoffmann u. Glaeske 2006). Zwei Übersichtsarbeiten legen nahe, dass sowohl für Stürze (Leipzig u.a., 1999) wie auch für Hüftfrakturen (Cumming u. Le Couteur 2003) die Halbwertszeit der Benzodiazepine nicht der entscheidende Faktor zu sein scheint. Vielmehr zeigen aktuellere Veröffentlichungen deutliche Hinweise darauf, dass gerade zu Beginn einer Behandlungs

16
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014Aus der Altersforschung
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
phase das Frakturrisiko als Folge von Gangunsicherheit, Einschränkung der Aufmerksamkeit und Gangsicherheit erhöht ist (Hoffmann u. Glaeske 2006; Wagner u.a. 2004).Bei all dem ist der besondere Charakter der Arzneimittel zu berücksichtigen: Arzneimittel werden von Ärztinnen oder Ärzten verschrieben, von Apothekerinnen und Apothekern verkauft, es steht also nicht unbedingt die eigene Entscheidung für einen Missbrauch dieser Mittel im Vordergrund, sondern ein Missbrauch und eine Abhängigkeitsentwicklung, die von Experten begleitet wird. Daher ist die Verantwortung dieser Ex perten auch vor allem gefragt, wenn es um die Prävention dieser „Sucht auf Rezept und aus der Apotheke“ geht. Denn es sind nicht nur verschreibungspflichtige Mittel, die zur Abhängigkeit führen können, es sind auch Mittel aus der Gruppe der 630 Mio. verkauften Packungen der Selbstmedikation, die nicht unproblematisch sind: Abschwellende Nasentropfen können ebenso auf Dauer (nach längerer Anwendung als 5 – 7 Tagen) zur Gewöhnung und Missbrauch führen wie alkoholhaltige Stärkungs und Grippemittel oder auch koffeinhaltige Schmerzmittelkombinationen wie Thomapyrin, die mit dem Hinweis auf eine 15 Minuten schnellere Wirkung beworben werden: Statt 80 Minuten wird 50% des Schmerzes bereits nach 65 Minuten reduziert. Als ob es darauf in der Selbstmedikation ankommt, wenn gleichzeitig das Risiko einer missbräuchlich häufigen Anwendung solcher Mittel wegen des leicht stimulierenden Koffeins möglich ist: Eine RisikoNutzenBewertung wird deshalb negativ ausfallen!
Information als wirksame Prävention
Die Bundesärztekammer hat 2007 einen Leitfaden für die ärztliche Praxis zum Umgang mit abhängigkeitsfördernden Arzneimitteln publiziert, die Apotheker haben im Jahre 2008 für ihren Bereich nachgezogen. Die ehemalige Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Sabine Bätzing, hatte dieses Thema im Jahre 2008 zum Schwerpunkt gemacht. Dies ist nachdrücklich zu unterstützen, es muss aber auch möglich sein, Verstöße gegen eine gute Verschreibungspraxis bei Ärzten oder gegen eine gute Beratungspraxis in
Apotheken zu ahnden, einzelne Prozesse, die abhängig gemachte Patientinnen und Patienten gegen ihre Ärzte anstrengen und tatsächlich auch „Schmerzensgeld wegen ihrer erlittenen seelischen Leiden“ einklagen konnten, sind da nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die für die „Ethik“ verantwortlichen Kammern der Ärzte und Apotheker sind hier ebenso in der Pflicht wie die für die Ökono mie zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen und Apothekerverbände. Eine einmalige Publikation von Leitfäden reicht da nicht aus – die Verschreibungs und Beratungspraxis muss vielmehr kontinuierlich überprüft werden, zum einen durch die Auswertung der Rezepte, zum anderen durch Testkäufe in Apotheken (pseudocustomer).Die Auswertung der Rezepte stößt aber mehr und mehr auf Probleme: Der Anteil der privat verordneten Mittel steigt ständig an! Während im ArzneiverordnungsReport Jahr für Jahr darauf hingewiesen wird, dass z.B. bei den Schlafmitteln das Problem der Verordnung abhängigkeitsinduzierender Arzneimittel deutlich zurückgeht – angeblich aufgrund wirksamer Informationen , zeigt der Packungsverbrauch in Deutschland insgesamt kaum Veränderungen: Die Menge der Packungen, die von der Industrie verkauft und über die Großhandlungen in die Apotheken gelangen, ist seit Jahren relativ konstant geblieben. Die Ärztinnen und Ärzte verordnen solche Mittel offensichtlich schlicht und ergreifend auf Privatrezepten, die Mittel werden dann von den Patientinnen und Patienten selber bezahlt, die Transparenz über die dauerhafte Verordnung von Arzneimitteln mit Suchtpotenzial wird damit verschleiert.Eine wirksamste Prävention ist letztlich die Vermeidung der „Nebenwirkung“ Abhängigkeit durch die richtige Anwendung von und Empfehlung für Arzneimittel. Fachleute wie Ärzte und Apotheker haben daher eine besondere Verantwortung, um die Patienten vor Missbrauch und Abhängigkeit zu schützen, das Angebot solcher Arzneimittel durch pharmazeutische Hersteller erzwingt schließlich noch keine Verordnung und keinen Verkauf. Vor allem bei den im Zusammenhang mit der Abhängigkeitsentwicklung noch immer wichtigsten Gruppe, den Benzodiazepinhaltigen Mitteln und den ZDrugs, sollte die 4 K –Regel immer beachtet werden:

17
Aus der Altersforschung Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
– Klare Indikation (das Medikament nur einnehmen, wenn eine medizinische Notwendigkeit be steht)
– Kleinste notwendige Dosis – Kurze Anwendung (maximal 14 Tage) – Kein abruptes Absetzen
Dieser Hinweis sollte in allen Arztpraxen und Apotheken aushängen und in den Beipackzettel aufgenommen werden, damit Experten und Patientinnen und Patienten die Gefährdung durch da Abhängigkeitspotenzial bestimmter Arzneimittel immer vor Augen haben.Autoreninfo und Kontakt:Prof. Dr. Gerd Glaeske ist Co-Leiter der Ab-teilung für Gesundheitsökonomie, Gesund-heitspolitik und Versorgungsforschung am Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universi-tät Bremen und war von 2003 bis 2009 Mit-glied im Sachverständigenrat zur Begutach-tung der Entwicklung im Gesundheitswesen.
Kontakt:[email protected]
Literatur:
Billioti de Gage S, Begaud B, Bazin F, Verdoux H, Dartiques JF, Peres K, Kurth T, Pariente A (2012) Benzodiazepine use and risk of dementias: prospective population bases study. BMJ (27) 345: e6231
Bitzer EM, Grobe TG, Neusser S, Dörning H, Schwartz FW (2008): GEKReport akutstationäre Versorgung 2008. St. Augustin: Asgard.
BoeufCazou O, Bongues B, Ansiau D, Marquie JC, LapeyreMestre M (2011) Impact of longterm benzodiazepine use on cognitive functioning in young adults: the VISAT cohort. Eur J Clin Pharmacol 67(10): 1045 – 52
Cumming RG, Le Couteur DG (2003): Benzodiazepines and risk of hip fractures in older people: a review of the evidence. CNS Drugs, 7(11): 825 – 837.
Cumming RG, Tinetti ME (1999): Drugs and falls in older people: a systematic review and metaanalysis: I. Psychotropic drugs. J Am Geriatr Soc, 47(1): 30 – 39.
Fastborn J, Forsell Y, Winblad B (1998) Benzodiazepine may have protective effects against Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord 12(1): 14 – 7
Gallacher J, Elwood P, Pickering J, Bayer A, Fish M, BenShlomo Y (2012) Benzodiazepine use and risk of dementia: evidence from the Caerphilly Prospective Study (CaPS). J Epidemiol Community Health 66 (10): 869 – 73
Glaeske G, Schulze J (2013) Der Einsatz von Benzodiazepinen bei Menschen mit einer Demenzerkrankung. In: Glaeske G, Schicktanz C: BARMER GEK Arzneimittelreport 2013. Asgard Verlag. S. 132 – 141
Glaeske, G., Schicktanz, C., Janhsen, K (2008): GEKArzneimittelreport 2008. St. Augustin: AsgardVerlag.
Glaeske G, Schicktanz C (2012) BARMER GEK Arzneimittelreport. Siegburg.
Glaeske G, Schicktanz C (2013) BARMER GEK Arzneimittelreport. Siegburg.
Grobe TG, Dörning H, Schwartz FW (2008): GEKReport ambulantärztliche Versorgung 2008. Asgard: St. Augustin.
Herings RM, Stricker BH, de Boer A, Bakker A, Sturmans F (1995): Benzodiazepines and the risk of falling leading to femur fractures. Dosage more important than elimination halflife. Arch Intern Med, 155(16):1801 – 1807.
Hoffmann F, Glaeske G (2006): Neugebrauch von Benzodiazepinen und das Risiko einer proximaler Femurfrakturen. Eine Casecrossover Studie. Z Gerontol Geriat, 39(2): 143 – 148.
Hoffmann F, Glaeske G, Scharffetter W (2006): Zunehmender Hypnotikagebrauch auf Privatrezepten in Deutschland. Sucht, 52(6): 360 – 366.
Hoffmann F, Scharffetter W, Glaeske G (2009): Verbrauch von Zolpidem und Zopiclon auf Privatrezepten zwischen 1993 und 2007. Nervenarzt. 2009 Jan 25. [Epub ahead of print].
IMSInstitut für Medizinische Statistik Health (2013): Der pharmazeutische Markt 2012. Franfurt a. M., EigenverlagLeipzig RM,
Madhusoodanan S, Bogunovic OJ (2004): Safety of benzodiazepines in the geriatric population. Expert Opin Drug Saf, 3(5): 485 – 493.
Mort JR, Aparasu RR (2002): Prescribing of psychotropics in the elderly: why is it so often inappropriate? CNS Drugs, 16(2): 99 – 109.
Ray WA, Griffin MR, Downey W (1989): Benzodiazepines of long and short elimination halflife and the risk of hip fracture. JAMA, 262(23): 3303 – 3307.
Verdoux H, Labnaoui R, Begaud B (2005) Is benzodiazepine use a risk factor for cognitive decline and dementia? A literature review of epidemiological studies. Psychol Med 35(3): 307 – 15
Wagner AK, Zhang F, Soumerai SB, Walker AM, Gurwitz JH, Glynn RJ, RossDegnan D (2004): Benzodiazepine use and hip fractures in the elderly: who is at greatest risk? Arch Intern Med, 164(14): 1567 – 1572.
Winter MH, Maaz A, Kuhlmey A (2006): Ambulante und stationäre medizinische Versorgung im Alter. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz, 49(6): 575 – 82.

18
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014Aus der Altersforschung
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Kurzinformationen aus der Altersforschung
Alkohol und Arzneimittelmissbrauch älterer Menschen in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen
Studie von S. Kuhn u. C. Haasen; Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Uni-versität Hamburg (ZIS)
Mit einer bundesweiten repräsentativen Befragung in den ambulanten und vollstationären Altenpflegeeinrichtungen wurde der Anteil von Menschen mit einem problematischen Gebrauch von Alkohol und Arzneimitteln sowie der Umgang mit dieser Gruppe erhoben.Methode: Es wurden 5 000 per Zufall ausgewählte Einrichtungen mit einem 2seitigen Fragebogen angeschrieben. Es nahmen 550 Einrichtungen der vollstationären Pflege und 436 Einrichtungen der ambulanten Pflege an der Befragung teil. Der prozentuale Anteil von Menschen mit Suchtproblemen in den Einrichtungen wurde mit 14 % angegeben. Fast alle Einrichtungen sehen sich in der Pflicht, auf diesen Problembereich zu reagieren, wobei nur ein Viertel der Einrichtungen ihr Personal für gut genug ausgebildet hält. Stationäre Einrichtungen haben zu 38,4 % und ambulante Einrichtungen zu 26,9 % ein Konzept für den Umgang mit dieser Personengruppe. Der Kontakt zum Suchthilfe system wird selten aufgenommen. Die Prävalenzen für einen Missbrauch von Alkohol und Arzneimitteln ist unter den älteren Pflegebedürftigen im Vergleich zur Altersgruppe in der Gesamtbevölkerung sehr hoch. Auffallend ist die mangelnde Vernetzung mit dem Suchthilfesystem.
Quelle: Alkohol- und Arzneimittelmissbrauch älterer Menschen in stationären und ambu-lanten Pflegeeinrichtungen. Gesundheits-wesen 2012; 74:331 – 336, Abstract
Modellprojekt Ältere Drogenabhängige in Deutschland
Irmgard Vogt, Natalie Eppler, Constance Ohms, Karin Stiehr, Margarita Kaucher
Das Bundesministerium für Gesundheit hat 2009 das Projekt „Ältere Drogenabhängige in Deutschland“ gefördert. Zielsetzung war es aufzuzeigen, welche Ressourcen zur Versorgung von älteren Drogenabhängigen in der Drogenhilfe bzw. in den stationären und ambulanten Bereichen der Altenhilfe vorhanden sind. Dabei sollte zum einen die Situation der Drogenabhängigen selbst (älter als 50 Jahre) zu ihrer Lebenssituation und ihren Vorstellungen zum Leben im Alter untersucht werden, zum anderen die vorhandenen Institutionen für eine adäquate Versorgung älterer Drogenabhängiger exemplarisch in den Städten Frankfurt/Main und Berlin beschrieben werden. Insgesamt wurden 50 qualitative Interviews durchgeführt sowie die institutionelle Situation in den beiden Städten recherchiert. Der Abschlussbericht belegt, dass in den beiden untersuchten Städten zwar ein sehr ausdifferenziertes Versorgungsnetz sowohl für den Bereich Suchthilfe als auch für den Bereich Altenhilfe existiert, die beiden Bereiche bislang aber noch wenig vernetzt sind. Die Schlussfolgerungen dienen als Anregungen für die Weiterentwicklung der Suchthilfe und der Altenpflegehilfe.
Der Abschluss- und Kurzbericht stehen auf den Seiten der Drogenbeauftragten zum Download zur Verfügung.
Quelle: www.drogenbeauftragte.de

19
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Wohnhilfen für alternde chronifiziert erkrankte Drogenabhängige – Projekt LÜSA Unna
Anabela Dias de Oliveira
Der Paradigmenwechsel der vergangenen Jahrzehnte hin zu einer akzeptanzorientierten Drogenhilfe und politik hat ein breites Spektrum von „Harm Reduction“Ansätzen möglich gemacht wie Substitutionsbehandlung, Streetwork, Kontaktcafés, Notschlafstellen, Wohnhilfen, Spritzentauschprojekte, drogentherapeutische Ambulanzen, Drogenkonsumräume, OriginalstoffVergabe. Der internationale Erfolg dieser akzeptierenden 1 niedrigschwelligen Hilfen ist unstrittig und wird insbesondere durch die hohe Absenkung der drogenbezogenen Todesfälle deutlich bestätigt. Heute konstatieren weltweit ehemalige Staatspräsidenten und andere Personen des öffentlichen Lebens wie Kofi Annan, als Mitglieder der „Global commission on drugs“, dass „der Krieg gegen Drogen gescheitert ist“ und sich nur gegen Menschen, die Konsumenten, richtet 2 . Mit einer Petition forderten in diesem Jahr weit über 100 deutsche Staatsrechtler die Bundesregierung zur politischen Umkehr auf 3.
In dieser Entwicklung ist auch 1996 die Gründung des VFWD e.V. (Verein zur Förderung der Wiedereingliederung Drogenabhängiger) durch leitende Mitarbeiter/innen verschiedener Drogenhilfeeinrichtungen der Region Dortmund zu sehen. Der Trägerverein beantragte ein Landesmodellprojekt zur Versorgung chronisch drogenabhängiger Menschen mit Mehrfachschädigung in der Großregion Dortmund bei dem damaligen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW.
Dieses wurde mit großer (fach)politischer Unterstützung bewilligt und im Herbst 1997 nahm das Projekt LÜSA (Langzeit Übergangs und StützungsAngebot) seine Arbeit als stationäre Einrichtung der Wiedereingliederungshilfe (SBG XII §§53, 54) in Kostenträgerschaft des überörtlichen Sozialhilfeträgers Landschaftsverband Westfalen Lippe in Unna auf.
Von Beginn an wurde der Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung und Differenzierung der Wohnhilfen und TagesstrukturAngebote gelegt.
Zielgruppe
Die LÜSAHilfeangebote richten sich an wiedereingliederungsfähige chronisch mehrfachschwerstgeschädigte drogenabhängige Menschen beiderlei Geschlechts, die nicht in der Lage sind, selbständig am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und von den herkömmlichen Drogenhilfeangeboten nicht mehr oder auch noch nicht erreicht werden.
Insbesondere sind dies Menschen, die in den 60er/70er Jahren begonnen haben, Drogen zu konsumieren und den Ausstieg aus diesem drogenbezogenen Lebensstil aus vielfältigen Gründen nicht schafften oder/und wollten, die „noch immer dabei“, nach wie vor drogenabhängig sind. Sie konnten dank der in den 90er Jahren nach und nach einsetzenden akzeptanzorientierten Drogenhilfe überleben und konfrontieren nun das Drogenhilfesystem mit ihrem Alterungsprozess.
Die seit unserer Eröffnung aufgenommenen 377 Klient/inn/en (ca. 40 %Frauen) sind ausschließlich Menschen mit jahrzehntelangen chronifizierten Suchtverläufen insbesondere von illegalisierten Drogen. Mehr als die Hälfte ist über 45 Jahre alt und mehr als 60% unserer HilfeNutzer/innen sind seit über 20 Jahren drogenabhängig. Der Großteil der Bewohner/innen hat schwierige Biographien, ist schwer traumatisiert 4, wobei der zunehmend sich chronifizierende Drogenkonsum durchaus als verzweifelter „Selbstheilungsversuch“ gewertet werden kann. Ein anderer Teil hat in der Adoleszenz u.a. aus jugendlicher Ausprobierlust Drogen kon
Endnoten:
1 „Auch scheinbar unverständliches Drogenkonsumverhalten kann als eine persönliche Entscheidung mit einem anderen Wertekonzept akzeptiert werden, als ein Lebensstil selbst wenn man ihn niemals übernehmen wollte.“ (Schuller, K. u.a. 1990, S.15)2 „Diese Politik des Verbietens und Strafens, so steht es in der ProfessorenResolution, sei ‚gescheitert, sozialschädlich und unökonomisch’. Sie sei erstens schädlich für die Gesellschaft, weil sie die organisierte Kriminalität und den Schwarzmarkt fördere; und sie sei zweitens schädlich für die Drogenkonsumenten, die in ‚kriminelle Karrieren getrieben’ würden. Der Staat dürfe aber ‚die Bürger durch die Drogenpolitik nicht schädigen’“ (Süddeutsche Zeitung 07. 04.2014) Vgl. auch www.globalcommissionondrugs.org3 www.faz.net/aktuell/feuilleton/legalitaetalsletzteraus... 4 Vgl. auch Dirk R. Schwoon u. Michael Kausz (Hrsg.)1994, Psychose und Sucht, Freiburg, S. 133 f.

20
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
sumiert, ist süchtig geworden, hat durch Kriminalisierung, Zwangstherapie und der Konfrontation mit „totalen Institutionen“ (Gefängnis, Psychiatrie) zunehmend Stigmatisierungs, Ausgrenzungs und Randständigkeitserfahrungen gemacht, die entscheidend zur Chronifizierung beigetragen haben. Bei der Gesundheitssituation (nahezu 100% sind HCV und 25% HIV positiv, über 20% haben schwere Erkrankungen der Leber, der Lunge, u.a. Krebs, bzw. Diabetes, 50% leiden unter einer schweren Angststörung und 75% unter schweren Depressionen) und bei der Problemkomplexität unserer Zielgruppe ist Abstinenz zumeist keine realistische Zielsetzung. Überlebenssicherung, die Verhinderung von Verschlimmerung, die gesundheitliche, juristische und soziale Stabilisierung, die Zuführung zu medizinischer Behandlung (insbesondere die Verbesserung der BehandlungsCompliance) und die Vermittlung von Wissen über RisikoMinimierung, stehen deshalb im Projekt LÜSA im Vordergrund. Darüber hinaus ist das (Wieder)Erlernen von sozialverträglicherem Verhalten sich und anderen gegenüber ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt und kann nur durch Eigenmotivation gelingen. Rückfälle in alte Verhaltens und Konsummuster sowie andere Rückschritte, aber auch Scheitern, sind normale Bestandteile des Veränderungsprozesses. Druck und Zwang verursachen u. E. nur unproduktiven Widerstand, deshalb lehnen wir eine Anerkennung nach § 35 f. BtMG (Strafvollzugsaussetzung zugunsten einer Therapie, „Therapie statt Strafe“) ab. Aus unserer Sicht ist es unabdingbar wichtig, die Perspektive der Klient/inn/en einzunehmen, sie zu verstehen, und nicht nur zu ‚diagnostizieren’. Hier entsteht jüngst endlich eine positive Entwicklung, zunehmend werden alternative Sichtweisen 5 , sowie die Kompetenz von Selbsthilfe 6 beachtet. Die „Lebenswelt Drogenszene“ stellt – bei allen Belastungen – auch eine gewisse innere Kohärenz her, hat etwas Gemeinschaftsstiftendes. Das Verschwinden der Drogenszenen heute hat zunehmend auch negative Auswirkungen: Isolation, Vereinsamung, Verlust von SubKulturwissen, massiver Alkoholkonsum sind u.a. die Folgen, die es den Menschen schwerer machen, aus der Sucht heraus zu finden.
Wohnhilfen
Die LÜSAHilfeangebote stehen insbesondere Menschen aus NRW, Westliches Westfalen – Großraum Dortmund, zur Verfügung; derzeit werden insgesamt 36 stationäre Plätze in verschieden konzipierten stationären Wohnhilfen vorgehalten, der Regelaufenthalt beträgt 2 Jahre (jedoch bleiben über 22% länger als 8 Jahre), sowie eine differenzierte Tagesstruktur und „Ambulant Betreutes Wohnen“ .
HaupthausDas Haupthaus ist gleichzeitig Vereinssitz und zentrale Anlaufstelle und bietet seit 1997 in einer großen, denkmalgeschützten Jugendstilvilla auf 3 Etagen 19 WohnPlätze, die meisten als Einzelzimmer. Die verkehrsgünstige Lage in direkter Nachbarschaft zur Fußgängerzone ermöglicht eine gute Einbindung in den „sozialen Raum Stadt Unna“. Am selben Standort und mit der gleichen konzeptionellen Verortung befindet sich seit 2008 auch das europaweit modellhafte barrierefreie/behindertengerechte Wohnangebot für 5 mehrfach schwerstgeschädigte chronische drogenabhängige Menschen mit Körperbehinderung. Diese Zielgruppe hat vielfach über drogenbezogene Unfälle bzw. als FolgeErkrankung des o. g. ruinösen Drogenkonsums (Venenerkrankungen, Polyneuropathie, Überdosierungsfolgen etc.) Versteifungen und Amputationen insbesondere der Beine zu verkraften.
AußenwohngruppeFür die Teilzielgruppe, die trotz schwieriger Ausgangslage die Hilfeangebote nutzt und auf gesunde Ressourcen rückgreifen, sich stabilisieren und Veränderungsprozesse stabil umsetzen kann, bieten wir (fußläufig zum Haupthaus) eine AußenWohngruppe mit 4 stationären Plätzen an. Die Arbeit mit diesen Klient/inn/en konzentriert sich auf die Ablösung, das Herauswachsen aus dem stationären Rahmen ggf. mit Überleitung in das Hilfeangebot „Ambulant Betreutes Wohnen“.
Stationäres dezentrales Einzelwohnen (SEWO)Ein Teil unserer Bewohner/innen (häufig Menschen mit psychotischen Störungen) hat große Schwierigkeiten, sich mit anderen
5 Vgl. Akzept e.V., Deutche AidsHilfe et al. (Hrsg) 2014, Alternativer Sucht und Drogenbericht .6 Vgl. JES Bundesverband e.V. (Hrsg.) 2014: „Meine Behandlung – Meine Wahl“

21
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Menschen (besonders in größeren Gruppen) zurecht zu finden, benötigt jedoch gleichzeitig verbindliche BetreuungsStrukturen: Sie haben aufgrund ihrer vielfältigen Störungen einen überdurchschnittlich hohen Hilfebedarf und benötigen Ruhe und ausreichend geschützten Rückzugsraum.
Ambulant Betreutes WohnenDas Angebot des Ambulant Betreuten Wohnens zielt auf chronisch drogenabhängige Menschen mit Mehrfachschädigungen, die das Projekt LÜSA durchlaufen haben, sowie drogenabhängige Menschen aus dem Kreis Unna, die vorübergehend oder für längere Zeit nicht selbständig ohne professionelle Hilfen leben können. Diese Menschen haben bereits Entwicklungsschritte geleistet und eine Stabilisierung (auch bezüglich ihres Beigebrauchs) erreicht. Aufgrund der Komplexität der Gesamtstörung benötigen sie jedoch weiterhin einen verlässlichen Betreuungsrahmen, um die erreichte Stabilisierung halten zu können.
Damit eine adäquate Weiterführung der medizinischen Versorgung, sowie eine fortlaufende Schulung des Teams, möglich sind, wird LÜSA von verschiedenen (Fach)Ärzten begleitet. Die verordneten Substitutionsmittel und Medikamente werden durch Apotheken geliefert und von den LÜSAMitarbeiter/inne/n, die entsprechend geschult wurden, im Auftrag des Arztes täglich in der Einrichtung gestellt und vergeben.
Dienstleistungen der Einrichtung
Wir bieten „Nischen zum Leben und Arbeiten“, Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Der in allen LÜSAHilfeangeboten angewandte lösungsorientierte ArbeitsAnsatz basiert als „Hilfe zur Selbsthilfe“ auf vier Säulen:
Ein Zuhause welches sicher, empathisch, unterstützend, warm, angenehm, mit wohlwollenden Menschen, gestaltet ist. Für uns ein Menschenrecht! Wir fordern von unseren Bewohner/inne/n Beteiligung, Verantwortung und sozial verträgliches Verhalten.
Behandlung Ein wesentliches BasisAngebot ist das Vorhalten einer Substitutionsbehandlung und fortlaufende medizinische Begleitung durch einen Hausarzt und einen Psychiater. Darüber hinaus pflegen wir die Kooperation mit Anbietern von Qualifizierter Entzugsbehandlung, Ergotherapiepraxen, Ambulanten Pflegediensten, sog. „Wundmanagern“, Hospizen. Neben den unterschiedlichen externen Hilfen, die vielfach auch ins Haus kommen, sind eigene Angebote aus den Bereichen Ergotherapie, Snoozle und Entspannungspädagogik konzeptioneller Bestandteil. LernAnsätze zur RisikoMinimierung und Beigebrauchsminimierungstrainings (insbesondere in Kooperation mit der örtlichen AIDSHilfe oder im Rahmen der SelbsthilfeFörderung über peers vermittelt), gehören dazu (das LÜSATeam ist in „KISS“ – Kontrolle im selbstbestimmten Substanzkonsum 7, und „PEGPAK“ 8 geschult).
Betreuung Wir orientieren auf die Gegenwart und stärken die Selbstbestimmung unserer Klient/inn/en. Deshalb arbeiten wir lösungsorientiert statt problemfokussierend. Themenbezogene Gruppen, Konflikt und Organisationsgruppen, Klein und Großgruppen, medizinische, juristische und soziale Beratung sind Kernarbeitsbereiche. Eine konstante und kontinuierliche Einzelbetreuung sowie eine verlässliche 24StundenPräsenz, die auch in der Nacht vertraute Gesprächspartner bietet, sind weitere wesentliche Betreuungsschwerpunkte. Im Einzellfall begleiten wir auch sterbende Klient/inn/en bis zum Tod, sofern im Hause realisierbar.
Tagesstruktur/Beschäftigung Neben dem Selbstversorgungsansatz stellen Alltagstraining und die Beschäftigungsbereiche Druck, Holz, Fahrrad und Kreativwerkstatt, der Verkaufsbereich mit dem SecondhandLaden „LÜLa“, dem Antikladen, der Versorgungsbereich mit Garten, Renovierungs, Hauswirtschaftstätigkeiten sowie die differenzierten Freizeitangebote in unserer Arbeit einen großen Wert dar.Die Tagesstruktur, die Beschäftigungsangebote, der Selbstversorgungsansatz, das Alltagstraining sowie die pädagogisch orientierten Einzel und Gruppengespräche sollen die
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
7 S. Franz Trautmann und Cas Barendregt, Europäisches PeerSupport Handbuch, NIADProject ‚Aids en Druggebruik’, Utrecht/NL 1994, www.kissheidelberg.de/kissheidelberg/de/2/0/programm/kiss.aspx8 Theo Wessel, Heinz Westermann, Problematischer Alkoholkonsum. Das psychoedukative Schulungsprogramm PEGPAK, in: Suchttherapie: Prävention, Behandlung, wissenschaftliche Grundlagen, Jg. 3 (2002), H. 2, S. 97 – 102

22
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Menschen auf die Entlassung in selbständiges Wohnen vorbereiten – das große Ziel der meisten LÜSAKlient/inn/en. Dieses Ziel können unsere Klient/inn/en nur erreichen, wenn sie (wieder) lernen, selbstbestimmt Verantwortung zu übernehmen.Wir leiten die Bewohner/innen bei den Dingen an, die sie nicht mehr bzw. noch nicht können, wir arbeiten mit ihnen zusammen, aber wir übernehmen die Alltagsbewältigung nicht für sie: Auch deshalb hat der von uns oben bereits beschriebene Selbstversorgungsansatz einen zentralen Stellenwert. Ziel ist es, Grundlagen zu schaffen für eine Erholung und eine eigenständige Lebensbewältigung, zunächst innerhalb des stark geschützten Rahmens der Einrichtung. Ohne den zeitstabilen Aufbau von Motivation, Hoffnung, Vertrauen, Mut und Perspektive wird die weitere Entwicklung kaum gelingen können. Auf diesem Hintergrund investieren wir in den ersten Monaten bewusst in Haltekraft – für uns ist sie Qualitätsmerkmal.
Kooperation und Gemeinwesen – wir nehmen das Miteinander wichtig
Der VFWD e.V. ist korporatives Mitglied der AWO Westliches Westfalen. Darüber hinaus sind wir Mitglied in verschiedenen Fachverbänden auf Bundes und Landesebene (wie Akzept Bundesverband e.V., u.a. relevante Verbände, AGs).Wir arbeiten mit allen Einrichtungen des sozialen und medizinischen Hilfessystems, des Arbeitsmarktes, aber auch vieler weiterer Angebote wie z. B. Vereinen und Einzelpersonen zusammen, die für die Betreuung der Bewohner/innen hilfreich sind. LÜSA hat die Gründung der „Tafel“ in Unna unterstützt, wirkt mit im „Runden Tisch gegen Gewalt und Rassismus“ und an dem jährlichen interkulturellen Fest „bUNt“ des Integrationsrates der Stadt Unna.Wir erwarten von den Bewohner/inne/n Respekt und einen demokratischtoleranten Umgang untereinander und mit anderen Bürger/inne/n.Wir konfrontieren unsere Klient/inn/en auch mit (bürgerschaftlichem) Engagement und gesellschaftspolitischen Hintergründen, die für sie als Bürger/innen relevant sind (Wahlen, Demonstrationen u.a.) kurz, wir beach
ten Bürgerrechte und pflichten und versuchen, einen Blick für die Welt um sie herum und weiter weg zu schaffen und zu schärfen.
Es ist uns wichtig, auch mit den Beschäftigungsangeboten Gemeinwesenbestandteil zu sein, und Bürger/inne/n, insbesondere denen mit geringem Einkommen, bezahlbare Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Darüber hinaus schätzen wir die damit verbundene positive Außendarstellung: Wenn die Bürger/innen des Gemeinwesens Unna drogenabhängige Bürger/innen mit Fähigkeiten und Ressourcen verbinden, ist das ein aktiver Beitrag gegen die gängige Stigmatisierung und Isolierung. Unser Selbstverständnis als Gemeinwesenbestandteil kann wie folgt knapp zusammengefasst werden: Partizipation zu fordern und zu fördern, unseren Klient/inn/en, da, wo ihre Stimme nicht gehört wird, eine parteiische Lobby zu sein.
Das LÜSA-Team
Neben Sozialarbeiter/inne/n wird das Team ergänzt durch interdisziplinäre Qualifikationen wie: Heil, Erziehungs, und Gesundheitspfleger/innen, „ExUser/innen“, Heil, und Diplompädagog/inn/en, Ergotherapeut/inn/en, Hauswirtschafter/inne/n, Verwaltungsangestellten, sowie den handwerklichen Anleiter/inne/n in den Tagesstrukturangeboten. Sie bilden eine breite und vielschichtige Sicht auf die Problemkomplexität der ProjektNutzer/innen und ihre Lösungswege.Wir sind multikulturell und familienfreundlich, bieten mit Überzeugung Teilzeitstellen auch auf Leitungsebene, nehmen unseren Ausbildungsauftrag ernst und beschäftigen junge Menschen (Freiwilliges Soziales Jahr, Praktikum, Hospitation), sind ErgotherapiePrüfeinrichtung, als Ausbildungsbetrieb bei der IHK anerkannt und bieten durch die Arbeitsagentur geförderte Arbeitsplätze an.
Umgang mit Tod und Sterben
Die Mehrheit unserer Bewohner/innen kämpft gegen vielfältige oft schwere somatische Erkrankungen, so dass wir immer wieder mit Sterben und Tod konfrontiert sind.

23
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Zu unserem Verständnis von „Sterben in Würde“ gehört deshalb, dass sie auf ihrem letzten Weg nicht „abgeschoben“ werden in anonymes Sterben, sondern dass wir, Mitarbeiter/ innen wie ihre Mitbewohner/innen, sie begleiten, trösten, unterstützen, nicht allein lassen, im Krankenhaus, im Hospiz und im Einzelfall auch in ihrem Zuhause – bei LÜSA. In solchen Phasen werden die anderen Klient/inn/en stark gefordert und oft grenzwertig belastet, sehen sie doch in dem Sterben ihres Mitbewohners nicht nur das schmerzliche Abschiednehmen, sondern auch sich selber, ihre stark geschädigte Gesundheit, ihr eigenes Sterben. Es ist dann intensive Einzelbetreuung notwendig, es sind dies Phasen besonders intensiver Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft, die Sterben und Tod immer mit einschließt. Es sind belastende – aber auch nahe (Betreuungs)Momente: Gerade hier wird unsere Rolle als „professioneller Familienersatz“ sehr deutlich. Wir richten meist die Trauerfeier aus und werden seit vielen Jahren dabei eng unterstützt von einem Pastor und einem örtlichen Bestatter, so dass die Trauerfeiern schön und individuell sind. Soweit gewünscht werden Mitbewohner/innen oder/und Freunde aus der Drogenszene und Verwandte in die Gestaltung (Auswahl von Musik, Blumenschmuck, Trauerschleifentext, TrauerRede) einbezogen.Wir nehmen von den Verstorbenen in einer gemeinsamen Trauerfeier Abschied, veröffentlichen eine individuelle Trauerannonce in der Tageszeitung (jedoch immer mit dem Zusatz: „wider das anonyme Sterben drogenabhängiger Menschen“). Wir bewahren das Gedenken an die Gegangenen durch Gedenktafeln an einem Ort unseres Gartens und beteiligen uns seit vielen Jahren mit öffentlichen Aktionen und Gedenkfeiern an dem jährlichen „Nationalen Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige – den 21. Juli“: Traditionell läuten die örtlichen Kirchen die Glocken für uns, wir essen an einer schön gedeckten Tafel mit unseren Klient/inn/en und Gästen aus der Bürgerschaft, Politik und Verwaltung und pflanzen zum Abschluss in unserem Garten ein Gedenkbäumchen.
Künftige Planungen: Die Dauerwohn-einrichtung
Lange Zeit waren alt werdende Drogenabhängige nur schwer vorstellbar, aber durch die Substitutions und damit einhergehende medizinische Versorgung erreichen immer mehr Junkies das Rentenalter. Viele Drogenabhängige weisen eine Voralterung von rund 15 Jahren auf. Alternde schwer somatisch erkrankte drogenabhängige mit deutlich eingeschränkter Lebenserwartung, oder/und Drogenabhängige mit besonders hoher Entwurzelung und weitgehendem Verlust der Steuerungsfähigkeit, die als chronisch behindert gesehen werden müssen und nicht mehr in der Lage sind bzw. sein werden, selbständig und ohne Betreuung zu leben, stellen die wachsende Teilgruppe dar, die zwar dank niedrigschwelliger Drogenhilfe überlebt hat, jedoch aufgrund ihrer ausgeprägten vielfältigen Schädigungen auch langfristig nicht in der Lage sein wird, selbständig zu leben.
Eine dauerhafte Versorgung für diesen Personenkreis gibt es bislang nicht. Es ist schwer, diese Klienten an konventionelle Altenheime zu vermitteln, die Berührungsängste gegenüber den Drogenabhängigen haben. Chronisch Drogenabhängige brauchen Methadon, auch im Alter, aber die Methadonvergabe wird vom Pflegepersonal in regulären Einrichtungen gefürchtet. Daneben gibt es auch die Angst, die Drogenszene in das eigene Umfeld zu holen. Aus diesen Gründen entstand die Idee einer Dauerwohneinrichtung für alternde Drogenabhängige. Sie sollten dort ihre letzten Jahre verbringen und in Würde sterben können.
Die Frage der Kostenträger war kompliziert: Schnittstellenprobleme und die ZuständigkeitsAbstimmung zwischen Renten, Kranken und Pflegeversicherer und dem LWL als überörtlichen Sozialhilfeträger langwierig. Letztlich haben die Besonderheit, die Problemkomplexität und die mangelnde Teilhabe dieser Zielgruppe für eine Verortung in der Behindertenhilfe gesprochen und die neue DauerwohnEinrichtung wird deshalb im Rahmen einer Ausweitung der vorhandenen Plätze und ebenfalls mit einer pauschalierten Pflegesatzfinanzierung (pro Tag/pro Kopf)

24
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
umgesetzt: Wiedereingliederung im Rahmen des SGB XII §53, 54 ist nicht nur definiert als eine gelingende Wiedereingliederung i.S. der Erreichung einer „selbst und eigenständigen Lebensführung in der Gemeinschaft“, sondern greift auch für lebenslange bzw. chronische Behinderungen im Sinne einer DennochTeilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Das Projekt LÜSA hat zur Versorgung der hier beschriebenen Zielgruppe ein Konzept für eine Dauerwohneinrichtung, angelehnt an die Konzepte moderner „SeniorenResidenzen“ entwickelt. Der konzeptionelle Ansatz soll dem Bedürfnis der Betroffenen nach selbstbestimmtem/selbständigem Leben auf der einen Seite und ihrem Bedürfnis nach Befriedigung ihres objektiven HilfeBedarfes soweit wie möglich entsprechen. Diese Wohnhilfe wird in Unna am Stadtrand ländlich gelegen sein, Ruhe, einen großen Garten, Barrierefreiheit und Weitläufigkeit in den Einzelzimmern und Gemeinschaftsräumen bieten. Zum Standard des Hilfsangebotes wird, wie in den anderen LÜSAWohnhilfen, die Substitutionsbehandlung (ggf. in einiger Zeit auch als Originalstoffvergabe mit Diamorphin) gehören. Neben den gesundheitsstabilisierenden und lebenserhaltenden Aspekten für die Betroffenen schafft diese die Grundlage für Compliance, um weitergehende Behandlung sicher zu stellen. Darüber hinaus stellt sie einen wichtigen Schutz gegenüber dem Überhandnehmen von Szeneverhalten in ihrem WohnNahfeld dar. Das Projekt betritt Neuland, befasst sich mit den „Schmuddelkindern“ der Süchtigen und in ersten Diskussionen wurde schnell der Begriff des „Altenheims für kranke Drogenabhängige“ geprägt. Tatsächlich bietet es eine Reihe von Ähnlichkeiten zum immer beliebter werdenden Seniorenwohnen, wenngleich das tatsächliche Lebensalter (ab ca. 45 Jahren) nicht dem in „normalen Seniorenheimen“ entsprechen wird.Auch alle weiteren bestimmenden Kriterien für die Gestaltung von Alltag und Zusammenleben unterscheiden sich und sind hier stark vom Leben in der Subkultur geprägt:
– Illegalität, Kriminalisierung, Stigmatisierung, – Prostitution & Beschaffungskriminalität, – Psychiatrie & Knasterfahrung,
– andere Sprache, – anderer Humor, – andere Rauscherfahrung, – andere Kleidung, – andere Musik, – andere Lautstärke, – anderer Wohnstil, und Raumbedarf, – andere Fähigkeiten, Unzulänglichkeiten, Hilfebedarfe und andere Gewohnheiten.
So groß die Unterschiede sind, das Bedürfnis, in Würde zu leben und alt zu werden in einer gewohnten und vertrauten Umgebung, unterscheidet sich jedoch nicht. Die zukünftigen „DAWO“Bewohner/innen können erwarten:
– eine empathische (sub)kultursensible Begleitung,
– eine Substitutionsbehandlung und kritische (Bei)GebrauchsBegleitung,
– eine medizinische Behandlung und Medikation (somatisch, psychiatrisch, ergotherapeutisch),
– (Beziehungs)Konstanz & Sicherheit und 24hPräsenz,
– eine angenehme Umgebung mit (teil)selbstbestimmten (Lebens)Räumen,
– Akzeptanz für „BasisKonsum“, – eine lebendige Gemeinschaft, – Tagesstruktur (hier gemeint als individuelle Möglichkeit zur sinnvollen Füllung des Tages),
– einen eigenen Platz und eigene Aufgaben, „Gebrauchtwerden“, und die hohe Sicherheit, „Zuhause bleiben zu können“ auch bis zum Tod.
Unsere Haltung „Keinen verderben zu lassen, auch nicht sich selber – Jeden mit Glück zu erfüllen, auch sich, das ist gut“ 9 ist uns seit Eröffnung Orientierung im kollegialen Umgang wie in der Arbeit mit unseren Bewohner/inne/n. Die Orientierung am Hilfebedarf des Einzelfalls erfordert einen hohen Anpassungsbedarf (das Bemühen um einen Ausgleich ist häufig prägendes Merkmal des LÜSAAlltages), anstrengend und lohnend zugleich.Das interdisziplinäre LÜSATeam wird auch in der „Dauerwohneinrichtung“ durch bewusstes Investieren in arbeitnehmerfreundliche Rahmenbedingungen und verschiedene professionelle Methoden, Supervison, Schulun
9 Berthold Brecht, aus: Der gute Mensch von Sezuan, GW Bd. 4, S. 1553, Ffm. 1967

25
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
gen, Fortbildungen, gestützt – wir bleiben „achtsam“.
Fallbeispiel
Herr W., 59 Jahre, seit 37 Jahren polytoxikomane Abhängigkeit vom Opiattyp, seit 20 Jahren Medikamentenabhängigkeit, etliche Therapieversuche, mehrere Psychiatrieaufenthalte, ca. 40 Entgiftungen/Beigebrauchsentgiftungen, seit 18 Jahren in Substitutionsbehandlung, seit 15 Jahren bei LÜSA.
Derzeitige medizinische Situation:Herr W. ist in Folge seiner vielfältigern Erkrankungen dauerhaft schwerbehindert (75%): hirnorganisches Psychosyndrom (HOPS), Chronische Hepatitis C, zerebrales Krampfleiden, schwere Depressionen, SozialphobieSyndrom.Er lebt seit über 20 Jahren ohne Unterbrechung in Einrichtungen des Hilfesystems, hat keine Freundschaften außerhalb der Drogenszene und keine Angehörigen. Insbesondere in Folge des langjährigen Medikamentenmissbrauchs hat Herr W. Hirnschädigungen davongetragen. Die ergotherapeutische Tagesstruktur ist für ihn eine wichtige Orientierung, jedoch ist er den Anforderungsbelastungen des Beschäftigungsangebotes häufiger nicht gewachsen, da seine Konzentrationsfähigkeit nur für kurze Zeiträume erhalten bleibt. Das Beschäftigungsangebot hat für ihn sicher eher einen „Beschäftigungstherapie“Charakter. Im Laufe seines LÜSAAufenthaltes hat sich seine Gesamtsituation medizinisch, sozial, juristisch stabilisiert, jedoch ist er auch langfristig zu krank und psychisch gestört, um selbständig wohnen zu können. Obwohl Herr W. selbst für die LÜSAZielgruppe eine ungewöhnlich lange Drogenkarriere hat, stellen die körperlichen Erkrankungen nicht das Hauptproblem dar, sondern die geistig psychische Beeinträchtigung in Verbindung mit seinem Alter.Seine Entwicklungsressourcen sind, auf dem Hintergrund seines Krankheitsverlaufes, nahezu erschöpft, den derzeitigen Stand ohne große Krisenverläufe zu halten ist die fach liche Zielsetzung – und ihm die Sicherheit zu bieten, dass er im Alter nicht allein ist.
Herr W. steht beispielhaft für den Teil unserer Bewohner/innen, für den unsere Betreuung bedeutet, Ihnen einen „professionellen FamilienErsatz“, ein Zuhause zu bieten, da zu sein, sie zu begleiten, Ihnen eine angenehme letzte Lebensphase und würdiges Sterben zu ermöglichen.
Schlussbemerkung
In den vergangenen Jahren haben über 377 Menschen bei LÜSA gelebt, gelacht, geweint, den Alltag gemeistert, ihren Beitrag zur Gemeinschaft geleistet, gerungen um eine Verbesserung ihrer Lebenssituation. Viele konnten wir unterstützen bei dem Aufbau einer selbstbestimmten Wohnperspektive, einige sind in ihrem „Zuhause“, wie wir denken und hoffen, gut von uns begleitet, würdevoll verstorben. Diesen Ansatz und die dahinterliegende Haltung werden wir in die Dauerwohneinrichtung mitnehmen. Autoreninfo und Kontakt:Anabela Dias de Oliveira, Diplom-Sozialar-beiterin, ist die Geschäftsführerin des VFWD e.V. und Leiterin des Projekts LÜSA
Kontakt: [email protected]
Literatur:
Akzept e.V., Deutsche AIDSHilfe, JES Bundesverband (Hrsg.) (2014) : Alternativer Sucht und Drogenbericht. PDF über www.akzept.org
Brecht, B. (1967): Der gute Mensch von Sezuan, Gesammelte Werke Bd. 4, Ffm: Suhrkamp
JES (Junkies ExUser Substituierte) (Hrsg.) (2013): „Meine Behandlung – meine Wahl“ www.meinebehandlungmeinewahl.eu
Schuller, K., Stöver, H. (1990): Akzeptierende Drogenarbeit, Freiburg: Lambertus
Schwoon, D. R., Kausz, M. (Hrsg.) (1994): Psychose und Sucht. Freiburg: Lambertus
Trautmann, F., Barendregt, C. (1994): Europäisches PeerSupport Handbuch, NIAD Project‚ Aids en Druggebruik’ Utrecht/TrimbosInstitut
Wessel, Theo und Heinz Westermann (2002): Problematischer Alkoholkonsum – Das psychoedukative Schulungsprogramm PEGPAK, in: Suchttherapie: Prävention, Behandlung, wissenschaftliche Grundlagen, Jg. 3, H. 2

26
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Projekt Suchtsensible Pflegeberatung
Missbrauch und Abhängigkeit von Medikamenten, aber auch von Alkohol, sind bei Menschen über 60 Jahren keine Seltenheit. Laut einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit schätzen Pflegekräfte, dass derzeit ca. 14 % der Menschen, die von ambulanten Pflegediensten und in stationären Einrichtungen betreut werden, Alkohol oder Medikamentenprobleme haben. Um dieser Problematik etwas entgegen zu setzen, haben die AOK Nordost und die Fachstelle für Suchtprävention Berlin das Gemeinschaftsprojekt „Suchtsensible Pflegeberatung“ ins Leben gerufen. Das Projekt ist deutschlandweit einmalig und startete Januar 2014 in Berlin mit einer ersten eintägigen Schulung für Beraterinnen und Berater aus den Pflegestützpunkten. Suchtsensible Pflegeberatung wird zunächst in den Berliner Pflegestützpunkten, ab Herbst 2014 in MecklenburgVorpommern und ab 2015 in Brandenburg angeboten. Als Beratungsstellen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sind die Pflegestützpunkte wesentliche Anlaufpunkte, um im Pflegealltag zu unterstützen. Das Thema Sucht wird in den Beratungen immer häufiger angesprochen. Sie entsteht insbesondere durch die jahrelange selbstverständliche Einnahme von Schmerzmedikamenten und Schlafmitteln. Die Folge davon sind häufig auch Stürze. Um dafür weiter zu sensibilisieren und damit die Beratungsmöglichkeiten in den Pflegestützpunkten zu professionalisieren, wurde das Konzept zur suchtsensiblen Pflegeberatung gemeinsam mit der Fachstelle für Suchtprävention Berlin entwickelt. …
Quelle: Presseinformation vom 25.02.2014
Sucht im Alter – Altenpfleger können helfen
Medikamente, Alkohol und Tabak sind unter alten Menschen in Deutschland weit verbreitet. Vor allem der Gebrauch von Medikamenten ist bei der Generation 60 plus oft problematisch. Häufig passiert dies in Alten und Pflegeheimen, in denen bis zu einem Viertel der über 70Jährigen von Psychopharmaka abhängig sein soll. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen bietet gemeinsam mit der BARMER GEK jetzt verstärkt Pflegekräften und Pflegedienstleitungen in den stationären Einrichtungen und der ambulanten Pflege Unterstützung beim Thema „Sucht im Alter“ an. Pflegerinnen und Pflegern kommt eine Schlüsselrolle zu im Kampf gegen Sucht im Alter. Sie können oft als Erste Veränderungen und gesundheitliche Probleme erkennen. Den alten Menschen aus ihrer Sucht zu helfen lohne sich zu jedem Zeitpunkt und sei immer dann am erfolgreichsten, wenn Pflegende, Ärzte und Angehörige gemeinsam aktiv werden. Diese könnten oft beseitigt werden, zum Beispiel wenn in Absprache mit den behandelnden Ärzten Medikationen verändert werden. Einen Einstieg in das Thema bietet die Broschüre „Medikamente, Alkohol, Tabak: Informationen für die Altenpflege“. Sie widmet sich vor allem dem Medikamenten und Alkoholmissbrauch, streift aber auch die Tabakabhängigkeit. Sie wendet sich sowohl an Pflege und Einrichtungsleitungen wie an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der ambulanten und stationären Altenpflege. Kurzgefasste wissenschaftliche Informationen werden durch Erfahrungen ausgewiesener Praktiker und Handlungsempfehlungen ergänzt. Die Broschüre kann kostenlos unter [email protected] oder in allen Geschäftsstellen der BARMER GEK angefordert werden.
Weitere Informationen gibt es unter www.unabhaengig-im-alter.de
Kurzinformationen aus Politik und Praxis der Altenhilfe

27
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
Aus dem DZA
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Das Forschungsdatenzentrum des DZA (FDZDZA)
Das FDZDZA ist eine vom Rat für Sozial und Wirtschaftsdaten akkreditierte Einrichtung des Deutschen Zentrums für Altersfragen. Seine Hauptaufgabe ist es, die Daten des Deutschen Alterssurveys (DEAS) und des Deutschen Freiwilligensurveys (FWS) analysefreundlich und dokumentiert der wissenschaftlichen Forschung zugänglich zu machen sowie Interessenten und Nutzer zu beraten. Die Mikrodaten des Deutschen Alterssurveys (DEAS) und des Deutschen Frei willigensurveys (FWS) stehen der wissenschaftlichen Forschung für nichtgewerbliche Zwecke kostenfrei zur Verfügung. Das Forschungsdatenzentrum DZA gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Zugang zu den im Rahmen des Alterssurveys und des Freiwilligensurveys erhobenen Informationen und berät sie bei deren Verwendung. Die anonymisierten DEAS und FWSDatensätze aller abgeschlossenen Befragungswellen und die Dokumentationsmaterialien sind kostenlos über das FDZDZA erhältlich. Voraussetzung für den Datenzugang ist der Abschluss eines Nutzungsvertrages.
Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) ist eine vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderte Langzeitstudie des DZA zum Wandel der Lebenssituationen und Alternsverläufe von Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Grundlage sind bundesweit repräsentative Befragungen im Quer und Längsschnitt von jeweils mehreren tausend Teilnehmern im Alter ab 40 Jahren. Die letzte Erhebung fand im Jahr 2011 statt.
Derzeit liegen Ergebnisse aus den ersten vier Erhebungswellen (1996, 2002, 2008, 2011) vor, über das FDZDZA sind für die vier abgeschlossenen Erhebungswellen Daten verfügbar.
Der Deutsche Freiwilligensurvey (FWS) ist eine repräsentative Befragung zum freiwilligen Engagement in Deutschland, die sich an Personen ab 14 Jahren richtet. Freiwillige Tätigkeiten und die Bereitschaft zum Engagement werden in telefonischen Interviews erhoben und können nach Bevölkerungsgruppen und Landesteilen dargestellt werden. Außerdem können die Engagierten und Personen, die sich nicht bzw. nicht mehr engagieren, beschrieben werden. Der Freiwilligensurvey ist damit die wesentliche Grundlage der Sozialberichterstattung zum freiwilligen Engagement und wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.Die Daten des Freiwilligensurveys wurden bislang in den Jahren 1999, 2004 und 2009 erhoben. Im Jahr 2011 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) dem DZA die wissenschaftliche Leitung des Freiwilligensurveys übertragen. Die Daten der Befragungen aus den Jahren 2009, 2004 und 1999 stehen Nutzerinnen und Nutzern über das FDZDZA zur Verfügung.
Informationen über das FDZ-DZA sind auf der Webseite des DZA verfügbar unter: www.dza.de/fdz.html.
Aus dem Deutschen Zentrum für Altersfragen

28
Informationsdienst Altersfragen 41 (5), 2014Aus der Altersforschung
Aus der Altersforschung
Aus Politik und Praxis der Altenhilfe
Aus dem DZA
DZA, Manfred-von-Richthofen-Str. 2, 12101 BerlinPVST, Deutsche Post AG Entgelt bezahlt
A 20690E
Informationsdienst Altersfragen im Internet: www.dza.de